
zurück
14.01.2019 Pique Dame
Realismus und Romantik
Welche Konsequenz hat die Verlegung der Handlung aus dem 18. Jahrhundert in die Gegenwart in Jossi Wielers und Sergio Morabitos Inszenierung von „Pique Dame“? Eine Reflexion von Thomas Rothschild.
Idealtypisch bieten sich für die Bühnenrealisierung eines Werks aus der Vergangenheit drei Möglichkeiten an: Man kann es in der Zeit lokalisieren, in der die Handlung spielt, man kann es in die Zeit seiner Entstehung transferieren oder in die Gegenwart (der Zuschauer) verlegen. Alle drei Möglichkeiten werden auf internationalen Opernbühnen genutzt: Mozarts Titus tritt mal im Römerkostüm auf, mal in der Kleidung des späten 18. Jahrhunderts, mal als unser Zeitgenosse. Es gibt auch noch die vierte Möglichkeit, das Geschehen mit einer anderen als den eben benannten Zeiten korrespondieren zu lassen, sofern innere Zusammenhänge dies konzeptuell nahelegen. Die Theatermacherinnen und Theatermacher heute streben meist ein spezifisches Mischungsverhältnis dieser verschiedenen Zeiten an.
Jossi Wieler und Sergio Morabito sind entschiedene Verfechter eines Musiktheaters, das sich der Gegenwart verpflichtet weiß, allerdings nicht in einem oberflächlichen Verständnis, das platte Analogien herstellt oder Eins-zu-eins-Beziehungen behauptet zwischen fiktiven Figuren oder Sujets der Vergangenheit und Personen oder aktuellen Geschehnissen der Gegenwart. Pique Dame ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Wie bei Eugen Onegin beruht das Libretto auf einer Vorlage Alexander Puschkins. Dessen gleichnamige Erzählung wurde 1834 veröffentlicht, sechs Jahre vor Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Geburt. Als dieser 1890 seine Oper schrieb, war der Stoff bereits historisch, sein Verfasser 53 Jahre tot und als klassischer Autor Russlands kanonisiert. Die biografische Nähe des nur neunzehn Jahre älteren Fjodor Dostojewski zu Tschaikowski war bedeutend dichter. An diese Tatsache knüpft die Konzeption der Stuttgarter Pique Dame an. Sie rückt die Oper, für die Tschaikowskis jüngerer Bruder Modest das Libretto verfasste, an Dostojewski und damit an Tschaikowskis Gegenwart heran. Zugleich aber sättigen das Bühnenbild und die Kostüme von Anna Viebrock die Handlung mit Elementen der Jetztzeit.
Jossi Wieler und Sergio Morabito sind entschiedene Verfechter eines Musiktheaters, das sich der Gegenwart verpflichtet weiß, allerdings nicht in einem oberflächlichen Verständnis, das platte Analogien herstellt oder Eins-zu-eins-Beziehungen behauptet zwischen fiktiven Figuren oder Sujets der Vergangenheit und Personen oder aktuellen Geschehnissen der Gegenwart. Pique Dame ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Wie bei Eugen Onegin beruht das Libretto auf einer Vorlage Alexander Puschkins. Dessen gleichnamige Erzählung wurde 1834 veröffentlicht, sechs Jahre vor Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Geburt. Als dieser 1890 seine Oper schrieb, war der Stoff bereits historisch, sein Verfasser 53 Jahre tot und als klassischer Autor Russlands kanonisiert. Die biografische Nähe des nur neunzehn Jahre älteren Fjodor Dostojewski zu Tschaikowski war bedeutend dichter. An diese Tatsache knüpft die Konzeption der Stuttgarter Pique Dame an. Sie rückt die Oper, für die Tschaikowskis jüngerer Bruder Modest das Libretto verfasste, an Dostojewski und damit an Tschaikowskis Gegenwart heran. Zugleich aber sättigen das Bühnenbild und die Kostüme von Anna Viebrock die Handlung mit Elementen der Jetztzeit.
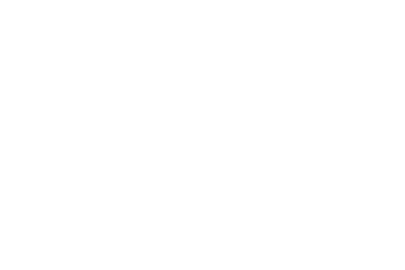
Die Eingangsszene von „Pique Dame“ mit Lise Davidsen als Lisa und Erin Caves als German (Foto: Martin Sigmund)
Schon während des Vorspiels visualisieren Wieler und Morabito ein wichtiges Motiv der Handlung. Ein junger Mann – German – sucht über eine Feuerleiter Zugang zu einer hinter einer Fensterluke erkennbaren Frau – Lisa –, die seine Sehnsucht zu teilen scheint, sich jedoch einem hinzutretenden soignierten Herren – Fürst Jeletzki – hingeben muss. Später soll sie German den Zutritt zu ihrer Großmutter, der alten Gräfin ermöglichen, deren Geheimnis mehr und mehr zum eigentlichen Objekt seines Begehrens wird. Zugleich erinnert German, wie er während Tomskis Ballade im 1. Akt der über steile Treppen und durch dunkle Korridore steigenden Gräfin nachspioniert, an Dostojewskis Helden Raskolnikow in Verbrechen und Strafe, der sich bei der alten Pfandleiherin einschleicht, um sie zu töten. In der Stuttgarter Inszenierung nimmt German den Rucksack nicht von seinem Rücken, auch nicht, wenn er um Lisa wirbt: Er bleibt – wie alle Figuren in der Lesart von Wieler / Morabito / Viebrock – ein Fremder, ein Entwurzelter. German (oder Germann – der Name ist die russifizierte Form von Hermann) ist eine der zahlreichen Figuren deutscher Herkunft, die in der russischen Literatur begegnen, von Schiller in Gogols Newski-Prospekt über Doktor Werner in Lermontows Ein Held unserer Zeit und Stolz in Gontscharows Oblomow bis zu mehreren Figuren in den Romanen Dostojewskis. Meist vertreten diese Figuren einen modernen bürgerlichen Rationalismus. In Puschkins Erzählung verliert German jedoch durch die Begegnung mit der alten Gräfin den Verstand.
Anna Viebrock hat eines ihrer charakteristischen Bühnenbilder entworfen. Es verschachtelt, wie so oft, Innen- und Außenräume. Erstmals freilich hat sie mit einer Drehbühne gearbeitet. Die Rotation der Bühne erschließt dem Blick aber nicht etwa Kontraste, sondern drei zwar unterschiedliche, aber doch immer ähnliche Varianten derselben architektonischen Elemente. Auf der unteren Etage erkennt man die abblätternden Wandverkleidungen eines aristokratischen Salons. Vor den Wänden sind in zwei Ausschnitten schäbige Kinostuhlreihen angebracht, die in vielfältiger Funktion Verwendung finden. Darüber ragen die kahlen Außenwände von Mietshäusern, deren Treppen und Galerien – in Österreich spräche man von Pawlatschen – die Innenhöfe einer Mietskaserne zu begrenzen scheinen. Sie versprechen und verweigern zugleich den Zugang zu verbotenen Räumen, das unzulässige Eindringen in verschlossene private Bereiche. Die Oberflächen sind nur teilweise mit akribischem Illusionismus bearbeitet, nackt gebliebene kulissenhafte Rückansichten erinnern daran, dass man es mit Theater zu tun hat.
Vom Adelsmilieu, in dem Tschaikowskis Oper teilweise spielt, sind nur noch Spurenelemente vorhanden, etwa der abbröckelnde Rokoko-Zierrat an den Wänden. Rokoko-Dekor ziert auch den hölzernen, mit Milchglasfenstern versehenen und von innen beleuchteten Kubus, der geisterhaft durch dieses Petersburger Stadtphantom gleitet: eine Mischung aus Kutsche, Beichtstuhl, Windfang, Straßenbahn und geheimnisvoller „siebter Kammer“, der die alte Gräfin immer wieder entsteigt.
Den eigenwilligsten Eingriff in die Inszenierungstradition von Pique Dame stellt der Entwurf der Titelfigur dar, mit der Stuttgarts Publikumsliebling Helene Schneiderman ihr Rollendebüt gab. Sie ist eine Stadtstreicherin, deren Erscheinung Altersaufnahmen von Greta Garbo zitiert, an Bette Davis’ Auftritt als Apfel-Annie in Die unteren Zehntausend erinnert, aber auch an Baudelaires Gedicht Die kleinen Alten denken lässt. Wie die Letzteren ist auch die alte Gräfin vom Mythos einer glanzvollen Jugend umstrahlt, dessen suggestivem Sog sich German ganz ähnlich überlässt wie der französische Dichter.
Anna Viebrock hat eines ihrer charakteristischen Bühnenbilder entworfen. Es verschachtelt, wie so oft, Innen- und Außenräume. Erstmals freilich hat sie mit einer Drehbühne gearbeitet. Die Rotation der Bühne erschließt dem Blick aber nicht etwa Kontraste, sondern drei zwar unterschiedliche, aber doch immer ähnliche Varianten derselben architektonischen Elemente. Auf der unteren Etage erkennt man die abblätternden Wandverkleidungen eines aristokratischen Salons. Vor den Wänden sind in zwei Ausschnitten schäbige Kinostuhlreihen angebracht, die in vielfältiger Funktion Verwendung finden. Darüber ragen die kahlen Außenwände von Mietshäusern, deren Treppen und Galerien – in Österreich spräche man von Pawlatschen – die Innenhöfe einer Mietskaserne zu begrenzen scheinen. Sie versprechen und verweigern zugleich den Zugang zu verbotenen Räumen, das unzulässige Eindringen in verschlossene private Bereiche. Die Oberflächen sind nur teilweise mit akribischem Illusionismus bearbeitet, nackt gebliebene kulissenhafte Rückansichten erinnern daran, dass man es mit Theater zu tun hat.
Vom Adelsmilieu, in dem Tschaikowskis Oper teilweise spielt, sind nur noch Spurenelemente vorhanden, etwa der abbröckelnde Rokoko-Zierrat an den Wänden. Rokoko-Dekor ziert auch den hölzernen, mit Milchglasfenstern versehenen und von innen beleuchteten Kubus, der geisterhaft durch dieses Petersburger Stadtphantom gleitet: eine Mischung aus Kutsche, Beichtstuhl, Windfang, Straßenbahn und geheimnisvoller „siebter Kammer“, der die alte Gräfin immer wieder entsteigt.
Den eigenwilligsten Eingriff in die Inszenierungstradition von Pique Dame stellt der Entwurf der Titelfigur dar, mit der Stuttgarts Publikumsliebling Helene Schneiderman ihr Rollendebüt gab. Sie ist eine Stadtstreicherin, deren Erscheinung Altersaufnahmen von Greta Garbo zitiert, an Bette Davis’ Auftritt als Apfel-Annie in Die unteren Zehntausend erinnert, aber auch an Baudelaires Gedicht Die kleinen Alten denken lässt. Wie die Letzteren ist auch die alte Gräfin vom Mythos einer glanzvollen Jugend umstrahlt, dessen suggestivem Sog sich German ganz ähnlich überlässt wie der französische Dichter.

Die Begegnung zwischen der Gräfin und German: Helene Schneiderman und Erin Caves in der Stuttgarter Inszenierung. (Foto: Martin Sigmund)
So gipfelt die Begegnung zwischen German und der Gräfin in der Stuttgarter Inszenierung in einem ekstatischen Liebesakt. Die Alte verwandelt sich in dieser Szene in eine leidenschaftliche junge Frau. Sie stirbt, sehr zum Verdruss Germans, ehe sie das Geheimnis der drei unfehlbaren Karten preisgeben konnte – aber nicht, wie das Libretto vorsieht, angesichts der Bedrohung durch seine Pistole, sondern in ihrer Liebesumarmung. Das verschiebt den Akzent und fügt eine (moderne) Dimension hinzu: Die alte Gräfin ersehnt, was sie bei Puschkin bloß fürchtet. Sie ist nicht nur Projektionsfläche für Germans Fantasie, sondern provoziert aktiv sein Begehren. Ihr Lachen und Schweigen bleibt, wie in der Vorlage, unheimlich und ein Machtmittel, aber darüber hinaus nutzt sie ihr wirkliches oder nur behauptetes Geheimnis, um Liebe zu erpressen. Hier weist die Inszenierung über Dostojewski hinweg auf eine Freud’sche Lesart voraus.
Wenn die Gräfin dann als Gespenst umgeht und ihr Geheimnis posthum verrät, verzichtet die Regie auf visuelle Mittel aus dem Arsenal des Gruselfilms. Sie ist in kein weißes Leintuch gehüllt, sondern erscheint in derselben Alltagskleidung, in der sie verstarb, als Frau von heute: Das T-Shirt der ehemaligen Vénus moscovite ziert die Aufschrift „I love Paris“. Noch einmal überquert sie während des Dialogs zwischen dem euphorisierten German und der erschrockenen Lisa die Bühne, beide zum Glücksspiel ins Casino ladend, ehe sie sich am Ende, nackt unter der Pelzrobe der „moskowitischen Venus“, auf den sterbenden German setzt – eine Reminiszenz an ihren tödlichen Liebesakt. Der Liebestod, den Tschaikowski German im Gegensatz zu Puschkin sterben lässt, findet seine überraschende szenische Beglaubigung.
Die Verlegung in die Gegenwart nimmt Vieldeutigkeit in Kauf, etwa die Verwischung der Ständeordnung des frühen 19. Jahrhunderts, in dem Alexander Puschkins Erzählung spielt. Wenn etwa die Gouvernante Lisas Freundinnen mahnt, sie sollten nicht „russisch tanzen“ und den „bon ton“ nicht vergessen, dann büßt das seine unmittelbare Plausibilität ein, wenn der Damenchor keine französisch sprechenden Aristokratinnen repräsentiert, sondern Bewohnerinnen eines Elendsviertels. Es gehört, nicht nur in diesem Fall, zur Methode von Wieler und Morabito, dass das Bühnengeschehen das Libretto nicht eindimensional illustriert, sondern weitere Bedeutungsebenen hinzufügt. Dazu gehört auch der Gebrauch von Ironie. Die Szene wird gleichsam als Spiel im Spiel interpretiert, nicht unähnlich dem in Anführungszeichen gesetzten Schäferspiel des zweiten Akts, mit dem Tschaikowski Mozart zitiert.
Akzeptiert man diese Irritationen, entsteht ein Bühnenereignis, das auf erstaunliche Weise sowohl die realistischen wie auch die romantischen Elemente des Stoffes in unsere ästhetische Gegenwart überführt. Einer realistischen Personenführung huldigt die Inszenierung vor allem auch in den bewegten Chören. Da steht sie ganz nah bei Felsenstein und im denkbar größten Kontrast zur radikalen Stilisierung etwa eines Achim Freyer im Berliner Eugen Onegin.
Im seinem Text Spielen, um der Kontrolle zu entkommen ruft Sergio Morabito zahlreiche – teils aus dem Material ableitbare, teils assoziative – literarische und historische Zusammenhänge auf: das bei Puschkin nicht vorhandene, von den Autoren der Oper eingeführte Motiv der Prostitution, Michail M. Bachtins Dostojewski-Analyse, den Roman Petersburg des Symbolisten Andrej Belyj oder Realien aus der sowjetischen Periode Leningrads. Es gibt eine Anekdote, wonach Sigmund Freud im Anschluss an die Interpretation eines Traums einmal gesagt hat: „Sie mögen einwenden, diese Deutung sei sehr gesucht. Darauf erwidere ich: Sie ist auch sehr gefunden.“ Diesen Ausspruch darf sich Sergio Morabito mit vollem Recht zu eigen machen.
Wenn die Gräfin dann als Gespenst umgeht und ihr Geheimnis posthum verrät, verzichtet die Regie auf visuelle Mittel aus dem Arsenal des Gruselfilms. Sie ist in kein weißes Leintuch gehüllt, sondern erscheint in derselben Alltagskleidung, in der sie verstarb, als Frau von heute: Das T-Shirt der ehemaligen Vénus moscovite ziert die Aufschrift „I love Paris“. Noch einmal überquert sie während des Dialogs zwischen dem euphorisierten German und der erschrockenen Lisa die Bühne, beide zum Glücksspiel ins Casino ladend, ehe sie sich am Ende, nackt unter der Pelzrobe der „moskowitischen Venus“, auf den sterbenden German setzt – eine Reminiszenz an ihren tödlichen Liebesakt. Der Liebestod, den Tschaikowski German im Gegensatz zu Puschkin sterben lässt, findet seine überraschende szenische Beglaubigung.
Die Verlegung in die Gegenwart nimmt Vieldeutigkeit in Kauf, etwa die Verwischung der Ständeordnung des frühen 19. Jahrhunderts, in dem Alexander Puschkins Erzählung spielt. Wenn etwa die Gouvernante Lisas Freundinnen mahnt, sie sollten nicht „russisch tanzen“ und den „bon ton“ nicht vergessen, dann büßt das seine unmittelbare Plausibilität ein, wenn der Damenchor keine französisch sprechenden Aristokratinnen repräsentiert, sondern Bewohnerinnen eines Elendsviertels. Es gehört, nicht nur in diesem Fall, zur Methode von Wieler und Morabito, dass das Bühnengeschehen das Libretto nicht eindimensional illustriert, sondern weitere Bedeutungsebenen hinzufügt. Dazu gehört auch der Gebrauch von Ironie. Die Szene wird gleichsam als Spiel im Spiel interpretiert, nicht unähnlich dem in Anführungszeichen gesetzten Schäferspiel des zweiten Akts, mit dem Tschaikowski Mozart zitiert.
Akzeptiert man diese Irritationen, entsteht ein Bühnenereignis, das auf erstaunliche Weise sowohl die realistischen wie auch die romantischen Elemente des Stoffes in unsere ästhetische Gegenwart überführt. Einer realistischen Personenführung huldigt die Inszenierung vor allem auch in den bewegten Chören. Da steht sie ganz nah bei Felsenstein und im denkbar größten Kontrast zur radikalen Stilisierung etwa eines Achim Freyer im Berliner Eugen Onegin.
Im seinem Text Spielen, um der Kontrolle zu entkommen ruft Sergio Morabito zahlreiche – teils aus dem Material ableitbare, teils assoziative – literarische und historische Zusammenhänge auf: das bei Puschkin nicht vorhandene, von den Autoren der Oper eingeführte Motiv der Prostitution, Michail M. Bachtins Dostojewski-Analyse, den Roman Petersburg des Symbolisten Andrej Belyj oder Realien aus der sowjetischen Periode Leningrads. Es gibt eine Anekdote, wonach Sigmund Freud im Anschluss an die Interpretation eines Traums einmal gesagt hat: „Sie mögen einwenden, diese Deutung sei sehr gesucht. Darauf erwidere ich: Sie ist auch sehr gefunden.“ Diesen Ausspruch darf sich Sergio Morabito mit vollem Recht zu eigen machen.