
zurück
30.10.2018 Ein neues Ritual der Trauer
Ein neues Ritual der Trauer
Mozarts berührendes Requiem, ihm gegenübergestellt Video-Bilder eines sterbenden Menschen. Mit dieser Anordnung wartet „Requiem pour L.“ auf, jüngstes Musiktheaterprojekt des Choreografen und Regisseurs Alain Platel und des Komponisten Fabrizio Cassol. Gemeinsam mit 14 Musiker*innen und Tänzer*innen aus Europa und Afrika interpretieren sie diese berühmteste Totenmesse der Musikgeschichte szenisch und musikalisch vollkommen neu. Die Vielfalt der musikalischen Sprachen und Ausdruckmittel der Beteiligten ist dabei Programm.
Über die gemeinsame Suche nach einem heutigen Ritual der Trauer, in dem all die unterschiedlichen Ausdrucksformen Platz finden, sprach der Musikjournalist Jean-Pierre Goffin mit dem Komponisten Fabrizio Cassol.
Über die gemeinsame Suche nach einem heutigen Ritual der Trauer, in dem all die unterschiedlichen Ausdrucksformen Platz finden, sprach der Musikjournalist Jean-Pierre Goffin mit dem Komponisten Fabrizio Cassol.
Jean-Pierre Goffin: Fabrizio Cassol, Requiem pour L. ist nicht Ihre erste Zusammenarbeit mit Alain Platel. Zusammen haben Sie bereits Monteverdis Marienvesper (vsprs, 2006) und Bachs Matthäuspassion (Pitié!, 2008) adaptiert sowie mit Musikern aus dem Kongo das abendländische Barock-Repertoire erkundet (Coup Fatal, 2014). Man darf allerdings vermuten, dass, so wie sie Requiem pour L. angegangen sind, dieses Projekt für Sie und Alain Platel zu einer beispiellosen Erfahrung auf musikalischem und menschlichem Gebiet geworden ist.
Fabrizio Cassol: Jeder von uns hatte sehr persönliche Gründe, sich dem Thema Tod auf diese Weise zu nähern. Es ist für mich schwierig, hier für Alain Platel zu reden, aber die Tatsache, dass er davon immer wieder gesprochen hatte, machte mir klar, dass irgendwann die Zeit reif war, sich diesem Thema über eine Stückentwicklung vollkommen auszuliefern. Mozarts Requiem war dafür das ideale Werk, weil es symbolisch für die Trauermusik des Abendlandes steht. Nicht nur das: Die Tatsache, dass es beim Tod des Komponisten unvollendet blieb, ließ eine wunderbar offene Tür für zeitgenössische Realitäten wie das Multikulturelle und das Bedürfnis, einige unserer Riten zu überdenken.
Die Arbeit an der Musik hat mehrere Jahre in Anspruch genommen, angefüllt mit Arbeitssessions in Kinshasa, Kapstadt, Cassis und Gent. Wir haben die Partitur dieses Abends in einer leuchtenden, hellen Energie erarbeitet und dabei neue, manchmal jubelnde Visionen eingefügt. Zeitgleich ist Alain durch sehr intensive und schmerzhafte Momente des Abschieds von ihm nahestehenden Menschen gegangen. Die Mitwirkung von „L.“, jener Frau, deren Sterben das Video zeigt, ergab sich wie ein Wunder, sie macht uns ein Geschenk von faszinierender Großzügigkeit. Schritt für Schritt hat sich die Musik mit Alains Visionen verbunden. Er hat die Verbindungen zwischen der Präsenz von „L.“ und jedem der Musiker*innen geknüpft, während er ihnen zugleich ermöglicht, die Natürlichkeit ihrer Körper und ihrer Seelenlagen in einem beispiellosen Bühnenraum auszudrücken.
Fabrizio Cassol: Jeder von uns hatte sehr persönliche Gründe, sich dem Thema Tod auf diese Weise zu nähern. Es ist für mich schwierig, hier für Alain Platel zu reden, aber die Tatsache, dass er davon immer wieder gesprochen hatte, machte mir klar, dass irgendwann die Zeit reif war, sich diesem Thema über eine Stückentwicklung vollkommen auszuliefern. Mozarts Requiem war dafür das ideale Werk, weil es symbolisch für die Trauermusik des Abendlandes steht. Nicht nur das: Die Tatsache, dass es beim Tod des Komponisten unvollendet blieb, ließ eine wunderbar offene Tür für zeitgenössische Realitäten wie das Multikulturelle und das Bedürfnis, einige unserer Riten zu überdenken.
Die Arbeit an der Musik hat mehrere Jahre in Anspruch genommen, angefüllt mit Arbeitssessions in Kinshasa, Kapstadt, Cassis und Gent. Wir haben die Partitur dieses Abends in einer leuchtenden, hellen Energie erarbeitet und dabei neue, manchmal jubelnde Visionen eingefügt. Zeitgleich ist Alain durch sehr intensive und schmerzhafte Momente des Abschieds von ihm nahestehenden Menschen gegangen. Die Mitwirkung von „L.“, jener Frau, deren Sterben das Video zeigt, ergab sich wie ein Wunder, sie macht uns ein Geschenk von faszinierender Großzügigkeit. Schritt für Schritt hat sich die Musik mit Alains Visionen verbunden. Er hat die Verbindungen zwischen der Präsenz von „L.“ und jedem der Musiker*innen geknüpft, während er ihnen zugleich ermöglicht, die Natürlichkeit ihrer Körper und ihrer Seelenlagen in einem beispiellosen Bühnenraum auszudrücken.
Mozarts Requiem blieb unvollendet und wurde nach dem Tod des Komponisten von Joseph Eybler und Franz Xaver Süßmayr vervollständigt. Einige dieser hinzugefügten Teile haben Sie gestrichen, andere umgeschrieben oder durch neukomponierte Passagen ergänzt. Was hat Sie bei der Suche nach neuen Formen geleitet?
Ich bin vom Autographen Mozarts ausgegangen, weil man darin die unterschiedlichen Handschriften sehr klar identifizieren kann. Ich fragte mich, was wohl passieren würde, wenn man die fremden Hinzufügungen durch andere Einflüsse ersetzen würde?
In Mozarts Requiem ist alles um ein Vokalquartett herum konstruiert: Bass, Tenor, Alt und Sopran; und das mit der Unerbittlichkeit eines Quadrats, sodass alles sehr geschlossen daherkommt. Durch die Entscheidung für Terzette – drei Opernsänger*innen, drei nicht-klassische Sänger*innen, ein Harmonietrio, drei Likembes [Musikinstrument, bei dem Metalllamellen mit den Daumen angezupft werden], konnten wir zugleich sehr vollständig sein und doch wieder nicht ganz so vollständig, um nicht auch noch andere Inspirationsquellen integrieren zu können. Es war eine Arbeit wie am Webstuhl.
Die Mitwirkung afrikanischer Musiker*innen und Sänger*innen lässt vermuten, dass dieser Kontinent Sie sehr inspiriert hat?
Es geht nicht um eine geografisch verortbare Musik. Hätten wir kubanische Musiker eingesetzt, hätte irgendwer gesagt: Aha, kubanische Musik. Aber diese Musik ist ja nicht österreichisch, weil es Mozart ist, sie ist nicht belgisch, weil es Cassol ist, sie ist auch nicht afrikanisch, nur weil die Sänger*innen Afrikaner sind. Für mich ist die Persönlichkeit der Leute ausschlaggebend: Wenn eine bestimmte Person für die Konzeption des Projektes passt, dann ist es nicht in erster Linie entscheidend, woher sie kommt und welches Instrument sie spielt. Trotzdem bestimmt beides natürlich die Zusammensetzung des Ensembles und die Art, wie man gemeinsam musiziert.
Unsere Aufgabe bestand auch darin, mit all diesen feelings, diesen so gar nicht westlichen Auffassungen von Musik auf eine Weise umzugehen, dass sich in ihnen Andockstellen für sämtliche mozartschen Zutaten aufzeigen ließen, um so letztlich unsere eigene Musikgeschichte fortschreiben zu können.
Das Akkordeon steuert einen Harmoniebegriff bei, den es in dieser Form in Afrika nicht gibt; aber dieses Requiem funktioniert tatsächlich mit beidem! Würde man diesen Harmoniebegriff streichen, bräche man sogar wichtige Brücken ab; das Ganze würde an Kraft verlieren. Musik ist eine Art und Weise, mit seinem Körper in Schwingung zu geraten.
Ich bin vom Autographen Mozarts ausgegangen, weil man darin die unterschiedlichen Handschriften sehr klar identifizieren kann. Ich fragte mich, was wohl passieren würde, wenn man die fremden Hinzufügungen durch andere Einflüsse ersetzen würde?
In Mozarts Requiem ist alles um ein Vokalquartett herum konstruiert: Bass, Tenor, Alt und Sopran; und das mit der Unerbittlichkeit eines Quadrats, sodass alles sehr geschlossen daherkommt. Durch die Entscheidung für Terzette – drei Opernsänger*innen, drei nicht-klassische Sänger*innen, ein Harmonietrio, drei Likembes [Musikinstrument, bei dem Metalllamellen mit den Daumen angezupft werden], konnten wir zugleich sehr vollständig sein und doch wieder nicht ganz so vollständig, um nicht auch noch andere Inspirationsquellen integrieren zu können. Es war eine Arbeit wie am Webstuhl.
Die Mitwirkung afrikanischer Musiker*innen und Sänger*innen lässt vermuten, dass dieser Kontinent Sie sehr inspiriert hat?
Es geht nicht um eine geografisch verortbare Musik. Hätten wir kubanische Musiker eingesetzt, hätte irgendwer gesagt: Aha, kubanische Musik. Aber diese Musik ist ja nicht österreichisch, weil es Mozart ist, sie ist nicht belgisch, weil es Cassol ist, sie ist auch nicht afrikanisch, nur weil die Sänger*innen Afrikaner sind. Für mich ist die Persönlichkeit der Leute ausschlaggebend: Wenn eine bestimmte Person für die Konzeption des Projektes passt, dann ist es nicht in erster Linie entscheidend, woher sie kommt und welches Instrument sie spielt. Trotzdem bestimmt beides natürlich die Zusammensetzung des Ensembles und die Art, wie man gemeinsam musiziert.
Unsere Aufgabe bestand auch darin, mit all diesen feelings, diesen so gar nicht westlichen Auffassungen von Musik auf eine Weise umzugehen, dass sich in ihnen Andockstellen für sämtliche mozartschen Zutaten aufzeigen ließen, um so letztlich unsere eigene Musikgeschichte fortschreiben zu können.
Das Akkordeon steuert einen Harmoniebegriff bei, den es in dieser Form in Afrika nicht gibt; aber dieses Requiem funktioniert tatsächlich mit beidem! Würde man diesen Harmoniebegriff streichen, bräche man sogar wichtige Brücken ab; das Ganze würde an Kraft verlieren. Musik ist eine Art und Weise, mit seinem Körper in Schwingung zu geraten.
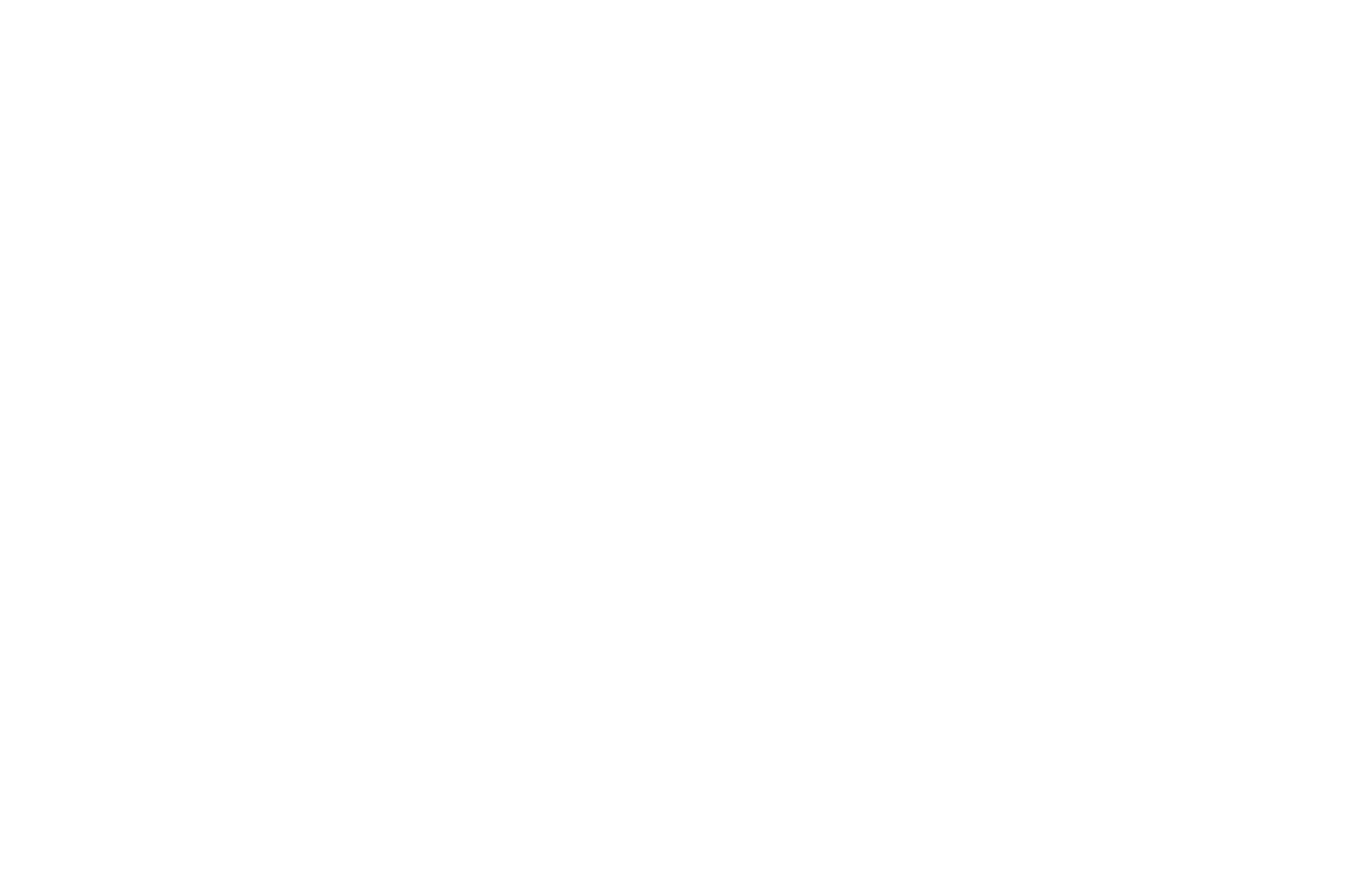
Szene aus "Requiem pour L." (Foto: Chris van de Burght)
Die Arbeit an diesem Stück ist also hauptsächlich eine intensive Auseinandersetzung mit Emotion?
Das ist absolut grundlegend in allem was ich tue: Man muss eine emotionale Architektur vermitteln können! Mozarts Requiem erfüllt die formalen Anforderungen der katholischen Totenmesse. Es ist die Musik einer Gemeinschaft, einer Menge, innerhalb der die wenigen Solist*innen von sich selbst nicht das Geringste preisgeben; vom Anfang bis zum Schluss gehorchen sie einer reinen Erzählfunktion. Sobald wir allerdings „L.“ ins Spiel bringen, diese Frau, deren Sterben die Kamera begleitet, müssen wir eine neue Art Zeremonie entwerfen.
Die starke Wirkung der geschlossenen Gruppe musste natürlich erhalten bleiben, während wir andererseits unser besonderes Augenmerk darauf richteten, dass die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Mitwirkenden sich ausdrücken können, dass sie sich auf ihre jeweils eigene, intime Weise „L.“ zuwenden können. Alle Künstler*innen sind ja auf der Suche nach Wahrhaftigkeit, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Was „L.“ angeht – es sind ihre letzten Augenblicke, die wir mit ihr teilen. Sie macht sie uns zum Geschenk. Bei allem, was wir tun, müssen wir uns dieser Tatsache völlig bewusst bleiben, wir stehen da einer sehr ausdrucksstark vermittelten Wahrheit gegenüber. Alain Platel schafft es immer wieder, solche Dinge an die Oberfläche zu zerren. Und jedes Mal bin ich erneut beeindruckt, wenn er sagt: „Spielt nicht fürs Publikum! Ihr habt gewisse Dinge unter euch auszumachen. Nur wenn ihr das tut, schöpft die Sache Kraft, und dann bekommt das Publikum den Eindruck, mit und um „L.“ herum zu sein, als wäre es ihre Familie im Moment ihres Fortgehens.“
Aus dem Französischen von Fränk Heller. Dieses Interview erschien zuerst in der 1. Ausgabe 2018/19 der Zeitung der Staatsoper Stuttgart. Hier wird eine gekürzte Version wiedergegeben. Die vollständige Fassung finden Sie hier.
Das ist absolut grundlegend in allem was ich tue: Man muss eine emotionale Architektur vermitteln können! Mozarts Requiem erfüllt die formalen Anforderungen der katholischen Totenmesse. Es ist die Musik einer Gemeinschaft, einer Menge, innerhalb der die wenigen Solist*innen von sich selbst nicht das Geringste preisgeben; vom Anfang bis zum Schluss gehorchen sie einer reinen Erzählfunktion. Sobald wir allerdings „L.“ ins Spiel bringen, diese Frau, deren Sterben die Kamera begleitet, müssen wir eine neue Art Zeremonie entwerfen.
Die starke Wirkung der geschlossenen Gruppe musste natürlich erhalten bleiben, während wir andererseits unser besonderes Augenmerk darauf richteten, dass die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Mitwirkenden sich ausdrücken können, dass sie sich auf ihre jeweils eigene, intime Weise „L.“ zuwenden können. Alle Künstler*innen sind ja auf der Suche nach Wahrhaftigkeit, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Was „L.“ angeht – es sind ihre letzten Augenblicke, die wir mit ihr teilen. Sie macht sie uns zum Geschenk. Bei allem, was wir tun, müssen wir uns dieser Tatsache völlig bewusst bleiben, wir stehen da einer sehr ausdrucksstark vermittelten Wahrheit gegenüber. Alain Platel schafft es immer wieder, solche Dinge an die Oberfläche zu zerren. Und jedes Mal bin ich erneut beeindruckt, wenn er sagt: „Spielt nicht fürs Publikum! Ihr habt gewisse Dinge unter euch auszumachen. Nur wenn ihr das tut, schöpft die Sache Kraft, und dann bekommt das Publikum den Eindruck, mit und um „L.“ herum zu sein, als wäre es ihre Familie im Moment ihres Fortgehens.“
Aus dem Französischen von Fränk Heller. Dieses Interview erschien zuerst in der 1. Ausgabe 2018/19 der Zeitung der Staatsoper Stuttgart. Hier wird eine gekürzte Version wiedergegeben. Die vollständige Fassung finden Sie hier.
Fabrizio Cassol & Alain Platel
Requiem pour L.
nach dem Requiem d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart
Mi 31.10.2018, 19.30 Uhr
Do 01.11.2018, 19.30 Uhr
Fr 02.11.2018, 19.30 Uhr
So 04.11.2018, 15.00 Uhr
Opernhaus Stuttgart
Eine Produktion von Les ballets C de la B, Festival de Marseille und den Berliner Festspielen
Requiem pour L.
nach dem Requiem d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart
Mi 31.10.2018, 19.30 Uhr
Do 01.11.2018, 19.30 Uhr
Fr 02.11.2018, 19.30 Uhr
So 04.11.2018, 15.00 Uhr
Opernhaus Stuttgart
Eine Produktion von Les ballets C de la B, Festival de Marseille und den Berliner Festspielen