
zurück
08.05.2025 Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
Essay
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
Egal welche Hautfarbe er mittlerweile auf der Bühne hat: Shakespeares Othello bleibt der Archetyp des ewig Fremden und eine permanente Projektionsfläche. Nur, wofür? Ein Beitrag von Jackie Thomae anlässlich der Premiere von Verdis „Otello“ im Opernhaus.
Ein erfolgreicher Mann, ein Aufsteiger. Ein Außenseiter, der nicht nur Karriere macht, sondern auch nach oben heiratet, was ihm zum Verhängnis werden soll. Ein Held, der fällt. Er ist der Mohr von Venedig, nicht der Mohr aus Venedig. Er bleibt der Fremde, auch wenn er es weit gebracht hat. Und er bleibt unter uns. Othello ist der Fußballprofi, der umjubelt wird, wenn er Tore macht, der aber sofort wieder zum Ausländer wird, wenn er einen Elfmeter vergeigt. Othello ist ein ehemaliger US-Präsident, dem man bis heute unterstellt, er sei in Kenia geboren, nicht in den USA, hätte somit nie ins Amt kommen dürfen, gehöre nicht dazu. Othello steckt in der Geschichte vom prominenten Politiker, der den Begriff »biodeutsch« populär gemacht hat, um selbstironisch und in feinstem Schwäbisch darauf hinzuweisen, dass er selbst kein indigener Deutscher sei. Schmerzlich deutlich ist die Othello-Parallele in der Geschichte des US-Footballstars zu erkennen, der für den Mord an seiner (blonden) Frau vor Gericht stand. Der trotz erdrückender Beweislage freigesprochen wurde – wegen eines Verfahrensfehlers, der mit Rassismus zu tun hatte. Trotzdem war aus dem Leben des vorher gefeierten Helden eine Tragödie geworden.
Othello taucht auch im britischen Königshaus auf. Spielte die Herkunft der Herzogin von Sussex eine Rolle? Beim Boulevard auf jeden Fall. Ob die Rassismusvorwürfe berechtigt waren oder nicht, wurde nie eindeutig geklärt, fest steht jedoch, dass eine Amerikanerin mit einer schwarzen Mutter in eine bis dahin blütenweiße Dynastie einheiratete, sich dort nicht wohlfühlte und samt Prinz und Baby zurück in die USA ging. Othello steckt auch in all den Biografien von Einwandererkindern, in denen man die immer gleichen Sätze liest: Ich sollte nicht aufs Gymnasium. Oder: Meine Eltern haben mir eingetrichtert, dass ich härter arbeiten muss als die anderen Kinder. Das hat auch Othello getan, er hat sich angepasst und hervorgetan, um dann festzustellen, dass das niemals reichen wird.
Othello taucht auch im britischen Königshaus auf. Spielte die Herkunft der Herzogin von Sussex eine Rolle? Beim Boulevard auf jeden Fall. Ob die Rassismusvorwürfe berechtigt waren oder nicht, wurde nie eindeutig geklärt, fest steht jedoch, dass eine Amerikanerin mit einer schwarzen Mutter in eine bis dahin blütenweiße Dynastie einheiratete, sich dort nicht wohlfühlte und samt Prinz und Baby zurück in die USA ging. Othello steckt auch in all den Biografien von Einwandererkindern, in denen man die immer gleichen Sätze liest: Ich sollte nicht aufs Gymnasium. Oder: Meine Eltern haben mir eingetrichtert, dass ich härter arbeiten muss als die anderen Kinder. Das hat auch Othello getan, er hat sich angepasst und hervorgetan, um dann festzustellen, dass das niemals reichen wird.
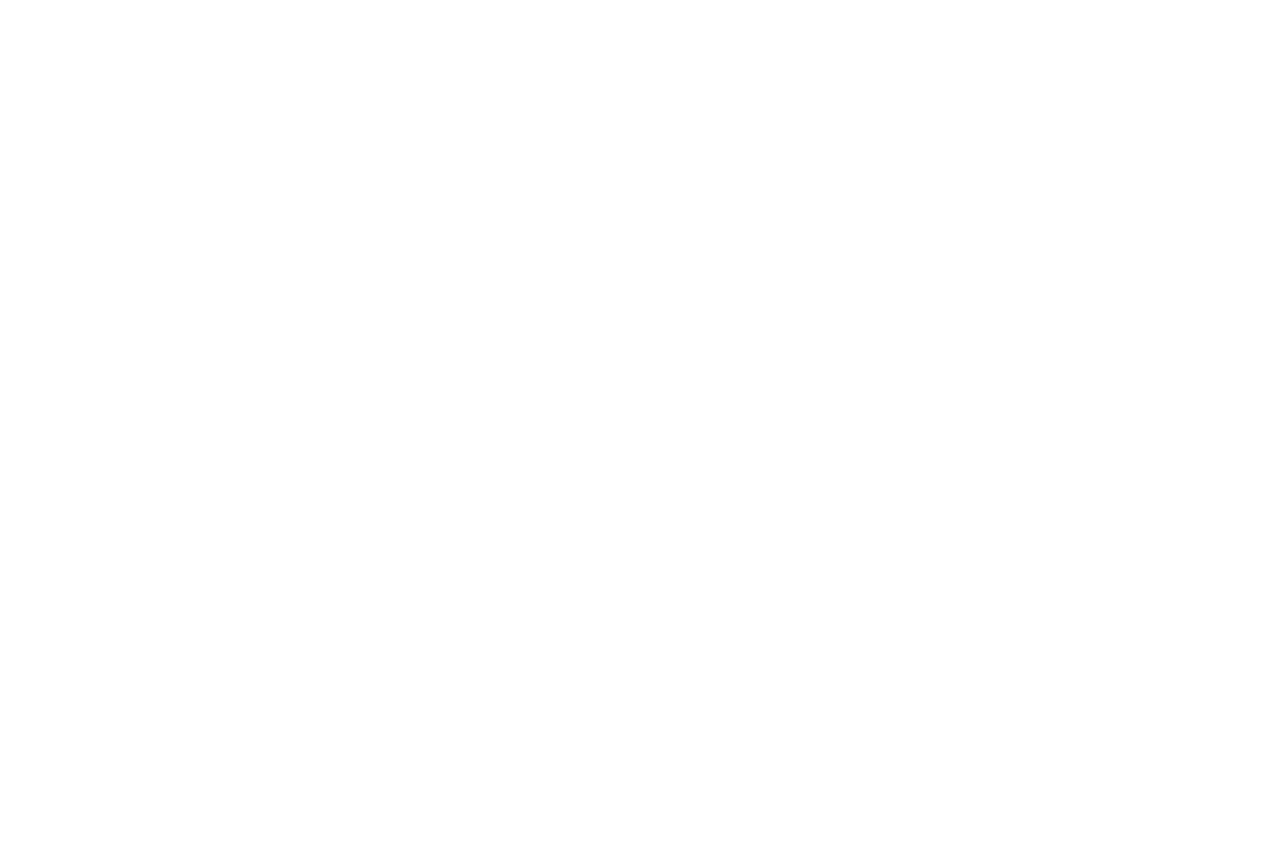
Verdis Oper als Sammelbild: Der Fleischextrakt-Hersteller Justus Liebig legte ab 1890 seinen Produktpackungen Sammelbilder bei, u.a. zu populären Opern wie dieses hier zu Otello. (Quelle: Wiki Commons)
Die Geschichte ist über 500 Jahre alt. William Shakespeare adaptierte sie aus einer Novellensammlung des italienischen Dichters Giambattista Giraldi. Arrigo Boito hat aus Shakespeares Vorlage das Libretto zu Giuseppe Verdis Oper geschrieben. Die Geschichte kam zurück nach Italien. Aus Othello wurde Otello. Verdi, zu diesem Zeitpunkt schon über siebzig, war begeistert. Der Komponist, der sich schon als Ruheständler gesehen hatte, fand darin den Stoff für eine seiner größten Opern, die bei ihrer Uraufführung 1887 in Mailand frenetisch gefeiert wurde.
»Der Otello ist der Mount Everest unter den Tenor-Rollen«, sagt Jon Vickers, der 1973 in der Verfilmung unter Herbert von Karajan die Hauptrolle sang. Ein Achttausender von Rolle, ein Kraftakt. »Otello steht fortwährend unter Strom«, beschreibt es Tenor Jonas Kaufmann. Das Libretto für das Dramma lirico bleibt nah an Shakespeares Version. Dessen Plot und Figurenensemble haben alles, was eine Tragödie braucht: Liebe, Eifersucht, Neid, Intrigen. Eine schöne Frau, einen starken Mann, einen legendär bösen Bösewicht. Und Exotik. Auch kann man diese universellen Zutaten mit nur ein paar Worten ins aktuelle Zeitgeschehen holen: Es geht um Diversität, Integration, soziale Mobilität. Um toxische Männlichkeit, Alkoholmissbrauch, Karriere; um Lügen, die bereitwillig geglaubt werden.
»Der Otello ist der Mount Everest unter den Tenor-Rollen«, sagt Jon Vickers, der 1973 in der Verfilmung unter Herbert von Karajan die Hauptrolle sang. Ein Achttausender von Rolle, ein Kraftakt. »Otello steht fortwährend unter Strom«, beschreibt es Tenor Jonas Kaufmann. Das Libretto für das Dramma lirico bleibt nah an Shakespeares Version. Dessen Plot und Figurenensemble haben alles, was eine Tragödie braucht: Liebe, Eifersucht, Neid, Intrigen. Eine schöne Frau, einen starken Mann, einen legendär bösen Bösewicht. Und Exotik. Auch kann man diese universellen Zutaten mit nur ein paar Worten ins aktuelle Zeitgeschehen holen: Es geht um Diversität, Integration, soziale Mobilität. Um toxische Männlichkeit, Alkoholmissbrauch, Karriere; um Lügen, die bereitwillig geglaubt werden.
Auch kann man diese universellen Zutaten mit nur ein paar Worten ins aktuelle Zeitgeschehen holen: Es geht um Diversität, Integration, soziale Mobilität. Um toxische Männlichkeit, Alkoholmissbrauch, Karriere; um Lügen, die bereitwillig geglaubt werden.
Die Geschichte ist über 500 Jahre alt. William Shakespeare adaptierte sie aus einer Novellensammlung des italienischen Dichters Giambattista Giraldi. Arrigo Boito hat aus Shakespeares Vorlage das Libretto zu Giuseppe Verdis Oper geschrieben. Die Geschichte kam zurück nach Italien. Aus Othello wurde Otello. Verdi, zu diesem Zeitpunkt schon über siebzig, war begeistert. Der Komponist, der sich schon als Ruheständler gesehen hatte, fand darin den Stoff für eine seiner größten Opern, die bei ihrer Uraufführung 1887 in Mailand frenetisch gefeiert wurde.
»Der Otello ist der Mount Everest unter den Tenor-Rollen«, sagt Jon Vickers, der 1973 in der Verfilmung unter Herbert von Karajan die Hauptrolle sang. Ein Achttausender von Rolle, ein Kraftakt. »Otello steht fortwährend unter Strom«, beschreibt es Tenor Jonas Kaufmann. Das Libretto für das Dramma lirico bleibt nah an Shakespeares Version. Dessen Plot und Figurenensemble haben alles, was eine Tragödie braucht: Liebe, Eifersucht, Neid, Intrigen. Eine schöne Frau, einen starken Mann, einen legendär bösen Bösewicht. Und Exotik. Auch kann man diese universellen Zutaten mit nur ein paar Worten ins aktuelle Zeitgeschehen holen: Es geht um Diversität, Integration, soziale Mobilität. Um toxische Männlichkeit, Alkoholmissbrauch, Karriere; um Lügen, die bereitwillig geglaubt werden. Othello könnte man eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostizieren, er kommt aus einer Schlacht um Zypern, um Europas Außengrenzen. Und schließlich findet tragischerweise ein Femizid statt. Doch eine Intrige bleibt eine Intrige, bleibt eine Intrige. Dasselbe gilt für Hass und natürlich für Liebe. Man versteht diese Geschichte auch ohne modernes Wording, weshalb sie uns meist in ihrer Urform erzählt wird. Komplizierter ist es, die Titelfigur zu modernisieren.
»Shakespeares Othello ist eine permanente Provokation, für vier Jahrhunderte war er das sichtbarste Porträt eines schwarzen Mannes in der westlichen Kunst«, schreibt der Theaterregisseur Peter Sellars im Vorwort zu Toni Morrisons Stück Desdemona. Ein fiktionaler Charakter aus der Renaissance wird zur gigantischen Projektionsfläche für alles, was man unter dem Begriff »fremd« zusammenfassen könnte. Und natürlich ändert sich die Definition dessen, was man als fremd sieht, im Lauf der Jahre und der Inszenierungen. Immer wieder wird deshalb betont, dass es nicht um Othellos Aussehen gehe, sondern um dessen Symbolcharakter.
»Der Otello ist der Mount Everest unter den Tenor-Rollen«, sagt Jon Vickers, der 1973 in der Verfilmung unter Herbert von Karajan die Hauptrolle sang. Ein Achttausender von Rolle, ein Kraftakt. »Otello steht fortwährend unter Strom«, beschreibt es Tenor Jonas Kaufmann. Das Libretto für das Dramma lirico bleibt nah an Shakespeares Version. Dessen Plot und Figurenensemble haben alles, was eine Tragödie braucht: Liebe, Eifersucht, Neid, Intrigen. Eine schöne Frau, einen starken Mann, einen legendär bösen Bösewicht. Und Exotik. Auch kann man diese universellen Zutaten mit nur ein paar Worten ins aktuelle Zeitgeschehen holen: Es geht um Diversität, Integration, soziale Mobilität. Um toxische Männlichkeit, Alkoholmissbrauch, Karriere; um Lügen, die bereitwillig geglaubt werden. Othello könnte man eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostizieren, er kommt aus einer Schlacht um Zypern, um Europas Außengrenzen. Und schließlich findet tragischerweise ein Femizid statt. Doch eine Intrige bleibt eine Intrige, bleibt eine Intrige. Dasselbe gilt für Hass und natürlich für Liebe. Man versteht diese Geschichte auch ohne modernes Wording, weshalb sie uns meist in ihrer Urform erzählt wird. Komplizierter ist es, die Titelfigur zu modernisieren.
»Shakespeares Othello ist eine permanente Provokation, für vier Jahrhunderte war er das sichtbarste Porträt eines schwarzen Mannes in der westlichen Kunst«, schreibt der Theaterregisseur Peter Sellars im Vorwort zu Toni Morrisons Stück Desdemona. Ein fiktionaler Charakter aus der Renaissance wird zur gigantischen Projektionsfläche für alles, was man unter dem Begriff »fremd« zusammenfassen könnte. Und natürlich ändert sich die Definition dessen, was man als fremd sieht, im Lauf der Jahre und der Inszenierungen. Immer wieder wird deshalb betont, dass es nicht um Othellos Aussehen gehe, sondern um dessen Symbolcharakter.
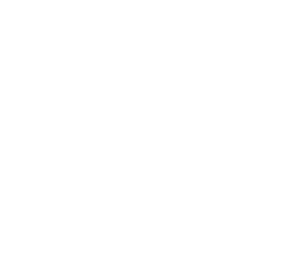
Othello, geblackfaced: Orson Welles in der Titelrolle seiner eigenen Othello-Verfilmung von 1951 gemeinsam mit Suzanne Cloutier als Desdemona (Quelle: Promotion-Foto der United Artists, Public Domain)
Trotzdem sorgt gerade diese Figur immer wieder für Kontroversen. Wie sah er aus? Wer darf ihn spielen und wie? Er ist ein Phantom, ähnlich der schwammig-xenophoben Umschreibung vom »südländischen Typen«, die man früher im Zusammenhang mit Straftaten benutzte. Den letzten großen Eklat löste 2022 die Inszenierung von John Neumeier aus, über die er sich mit dem Königlich Dänischen Ballett überwarf. »Blackbodying« und die Imitation afrikanischer Stammestänze waren den jungen Tänzer*innen zu klischeebeladen, der Starchoreograph war zu einer Änderung seines Stücks von 1985 nicht bereit. Der erste nicht dunkel geschminkte Othello im Kino war 1995 Laurence Fishburne. Vorher spielten ihn Orson Welles (1951) und Laurence Olivier (1965). Im New Yorker befürchtete der Autor Hilton Als, dass Oliviers beängstigend plumper Othello schwarzen Zuschauern den Stoff für immer vermiesen könnte. Auch Ulrich Wildgruber in Peter Zadeks Theaterinszenierung von 1976 gab den Othello so wild, dass er nicht nur Desdemona mit seiner schwarzen Schminke verschmierte, sondern auch das Publikum verstörte. »Die Zuschauer wollten aber einen schönen, edlen Othello«, sagte Eva Mattes, die Desdemona, viele Jahre später in einem Zeit-Interview.
Der edle Wilde ist allerdings auch ein Stereotyp. Othello, könnte man sagen, bringt nicht nur sich selbst, sondern auch seine Interpreten und Zuschauer regelmäßig in Rage. Und das nicht erst, seitdem an den meisten Spielorten konsequent auf das Blackfacing verzichtet wird, während andere finden, dass es in den darstellenden Künsten in der Natur der Sache liege, dass man sich verkleidet und maskiert, eben weil man einen anderen spielt. Doch die Debatte um den richtigen Othello bleibt auch eine Quelle der Kreativität.
Der edle Wilde ist allerdings auch ein Stereotyp. Othello, könnte man sagen, bringt nicht nur sich selbst, sondern auch seine Interpreten und Zuschauer regelmäßig in Rage. Und das nicht erst, seitdem an den meisten Spielorten konsequent auf das Blackfacing verzichtet wird, während andere finden, dass es in den darstellenden Künsten in der Natur der Sache liege, dass man sich verkleidet und maskiert, eben weil man einen anderen spielt. Doch die Debatte um den richtigen Othello bleibt auch eine Quelle der Kreativität.
Doch die Debatte um den richtigen Othello bleibt auch eine Quelle der Kreativität.
Trotzdem sorgt gerade diese Figur immer wieder für Kontroversen. Wie sah er aus? Wer darf ihn spielen und wie? Er ist ein Phantom, ähnlich der schwammig-xenophoben Umschreibung vom »südländischen Typen«, die man früher im Zusammenhang mit Straftaten benutzte. Den letzten großen Eklat löste 2022 die Inszenierung von John Neumeier aus, über die er sich mit dem Königlich Dänischen Ballett überwarf. »Blackbodying« und die Imitation afrikanischer Stammestänze waren den jungen Tänzer*innen zu klischeebeladen, der Starchoreograph war zu einer Änderung seines Stücks von 1985 nicht bereit. Der erste nicht dunkel geschminkte Othello im Kino war 1995 Laurence Fishburne. Vorher spielten ihn Orson Welles (1951) und Laurence Olivier (1965). Im New Yorker befürchtete der Autor Hilton Als, dass Oliviers beängstigend plumper Othello schwarzen Zuschauern den Stoff für immer vermiesen könnte. Auch Ulrich Wildgruber in Peter Zadeks Theaterinszenierung von 1976 gab den Othello so wild, dass er nicht nur Desdemona mit seiner schwarzen Schminke verschmierte, sondern auch das Publikum verstörte. »Die Zuschauer wollten aber einen schönen, edlen Othello«, sagte Eva Mattes, die Desdemona, viele Jahre später in einem Zeit-Interview.
Der edle Wilde ist allerdings auch ein Stereotyp. Othello, könnte man sagen, bringt nicht nur sich selbst, sondern auch seine Interpreten und Zuschauer regelmäßig in Rage. Und das nicht erst, seitdem an den meisten Spielorten konsequent auf das Blackfacing verzichtet wird, während andere finden, dass es in den darstellenden Künsten in der Natur der Sache liege, dass man sich verkleidet und maskiert, eben weil man einen anderen spielt. Doch die Debatte um den richtigen Othello bleibt auch eine Quelle der Kreativität. Es gab eine Inszenierung, in der alle Darsteller schwarz waren, und eine, in der Othello der einzige Weiße war. Am Deutschen Theater gab es Othello als Frau. Am Berliner Ensemble Othello in Rot. In Tokio gab es ihn in der Version des Noh-Theaters, in dem traditionell alle Schauspieler Masken tragen, und auch Bollywood hatte seinen Othello, der in der indischen Version Omkara hieß.
In Silvia Costas Inszenierung für die Stuttgarter Staatsoper wird die Frage nach seinem Aussehen geschickt überblendet. Der Tenor Marco Berti wird als Otello durch eine ausgeklügelte Licht-Schatten-Regie nicht nur sinngemäß, sondern tatsächlich zur Projektionsfläche. Für alle Figuren, für die Intrigen Jagos, für das Publikum.
Es gab eine Zeit, in der es unter schwarzen Schauspielern verpönt war, den Othello zu spielen. Paul
Robeson musste sich anhören, er hätte ihn nicht spielen, sondern einfach das sein müssen, was er schon war, nämlich ein schwarzer Mann. Andererseits war der Othello auch eine, wenn nicht die einzige Karrierechance für schwarze Schauspieler.
Der edle Wilde ist allerdings auch ein Stereotyp. Othello, könnte man sagen, bringt nicht nur sich selbst, sondern auch seine Interpreten und Zuschauer regelmäßig in Rage. Und das nicht erst, seitdem an den meisten Spielorten konsequent auf das Blackfacing verzichtet wird, während andere finden, dass es in den darstellenden Künsten in der Natur der Sache liege, dass man sich verkleidet und maskiert, eben weil man einen anderen spielt. Doch die Debatte um den richtigen Othello bleibt auch eine Quelle der Kreativität. Es gab eine Inszenierung, in der alle Darsteller schwarz waren, und eine, in der Othello der einzige Weiße war. Am Deutschen Theater gab es Othello als Frau. Am Berliner Ensemble Othello in Rot. In Tokio gab es ihn in der Version des Noh-Theaters, in dem traditionell alle Schauspieler Masken tragen, und auch Bollywood hatte seinen Othello, der in der indischen Version Omkara hieß.
In Silvia Costas Inszenierung für die Stuttgarter Staatsoper wird die Frage nach seinem Aussehen geschickt überblendet. Der Tenor Marco Berti wird als Otello durch eine ausgeklügelte Licht-Schatten-Regie nicht nur sinngemäß, sondern tatsächlich zur Projektionsfläche. Für alle Figuren, für die Intrigen Jagos, für das Publikum.
Es gab eine Zeit, in der es unter schwarzen Schauspielern verpönt war, den Othello zu spielen. Paul
Robeson musste sich anhören, er hätte ihn nicht spielen, sondern einfach das sein müssen, was er schon war, nämlich ein schwarzer Mann. Andererseits war der Othello auch eine, wenn nicht die einzige Karrierechance für schwarze Schauspieler.
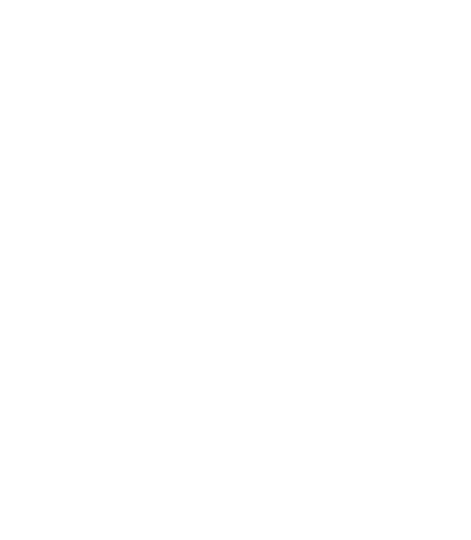
Der erste schwarze Othello überhaupt: Rollenporträt von Ira Aldridge, gemalt von Henry Perronet Briggs (Quelle: Google Cultural Institute)
Ira Aldridge debütierte 1826 als erster schwarzer Othello in London und wurde zum gefeierten Shakespeare-Darsteller. Seit diesem Februar gibt Denzel Washington den Othello am Broadway. In Joel Coens Film von 2021 spielte er den Macbeth. Ist ein schwarzer Macbeth gleichzusetzen mit einem weißen Othello? Ein Deal, sozusagen? Das wäre zu einfach. Die Figur bewegt sich nach wie vor auf einem Minenfeld, zwischen zu wenigen schwarzen Hauptrollen und zu vielen möglichen Klischees. Eine Herausforderung, die jedoch immer wieder angenommen wird. Kein Ruhestand für Othello, den Archetyp des Fremden. Denn es ist eine Geschichte, die erzählt wird, um dem Publikum das Herz zu zerreißen.
Kein Ruhestand für Othello, den Archetyp des Fremden. Denn es ist eine Geschichte, die erzählt wird, um dem Publikum das Herz zu zerreißen.
Ira Aldridge debütierte 1826 als erster schwarzer Othello in London und wurde zum gefeierten Shakespeare-Darsteller. Seit diesem Februar gibt Denzel Washington den Othello am Broadway. In Joel Coens Film von 2021 spielte er den Macbeth. Ist ein schwarzer Macbeth gleichzusetzen mit einem weißen Othello? Ein Deal, sozusagen? Das wäre zu einfach. Die Figur bewegt sich nach wie vor auf einem Minenfeld, zwischen zu wenigen schwarzen Hauptrollen und zu vielen möglichen Klischees. Eine Herausforderung, die jedoch immer wieder angenommen wird. Kein Ruhestand für Othello, den Archetyp des Fremden. Denn es ist eine Geschichte, die erzählt wird, um dem Publikum das Herz zu zerreißen. Die aufgebaut ist wie ein Krimi, bei dem die Zuschauer den perfiden Plan von Anfang an kennen, während die Handelnden ahnungslos in ihr Verderben tappen. »Wach auf! Tu es nicht!«, möchte das Publikum ihnen seit Jahrhunderten zurufen. Während es unterhalten wird, von Schauspieler*innen, Tänzer*innen, Sänger*innen und Musiker*innen in diese Tragödie hineingerissen wird, mit ihnen auf den Mount Everest steigt und ihnen beim Fallen zusieht. Sie alle erzählen uns die Geschichte vom Fremden, von der Macht der Liebe, der Macht der Lüge immer wieder aufs Neue. Weil wir sie immer wieder hören wollen.
Jackie Thomae, geboren in Halle/Saale, lebt in Berlin. Die Journalistin und Fernsehautorin stand mit ihrem zweiten Roman Brüder auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2019 und wurde mit dem Düsseldorfer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Zuletzt legte sie den Roman Glück vor.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der Nr. 3 2024/25 von Reihe 5, dem Magazin der Staatstheater Stuttgart.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der Nr. 3 2024/25 von Reihe 5, dem Magazin der Staatstheater Stuttgart.
Giuseppe Verdi
Otello
Okt 2025
Nov 2025