
zurück
13.03.2019 White Limozeen
„White Limozeen“ und ein „Requiem für die Norm“
Bei der Langen Nacht der Museen am 23. März 2019 sowie am 24. März 2019 finden insgesamt drei Vorstellungen der Musiktheater-Performance „White Limozeen“ von Johannes Müller und Philine Rinnert im Württembergischen Kunstverein Stuttgart statt. Passend zur derzeit dort gezeigten Ausstellung Lorenza Böttner. „Requiem für die Norm“, ist doch auch für das Berliner Kollektiv die Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Diskurs über körperliche Normen und Geschlechterzuschreibungen zentraler Moment in ihren Arbeiten. Gemeinsam haben sie die Ausstellung unmittelbar nach ihrer Eröffnung besucht. Regisseur Johannes Müller hat seine Eindrücke für uns niedergeschrieben.
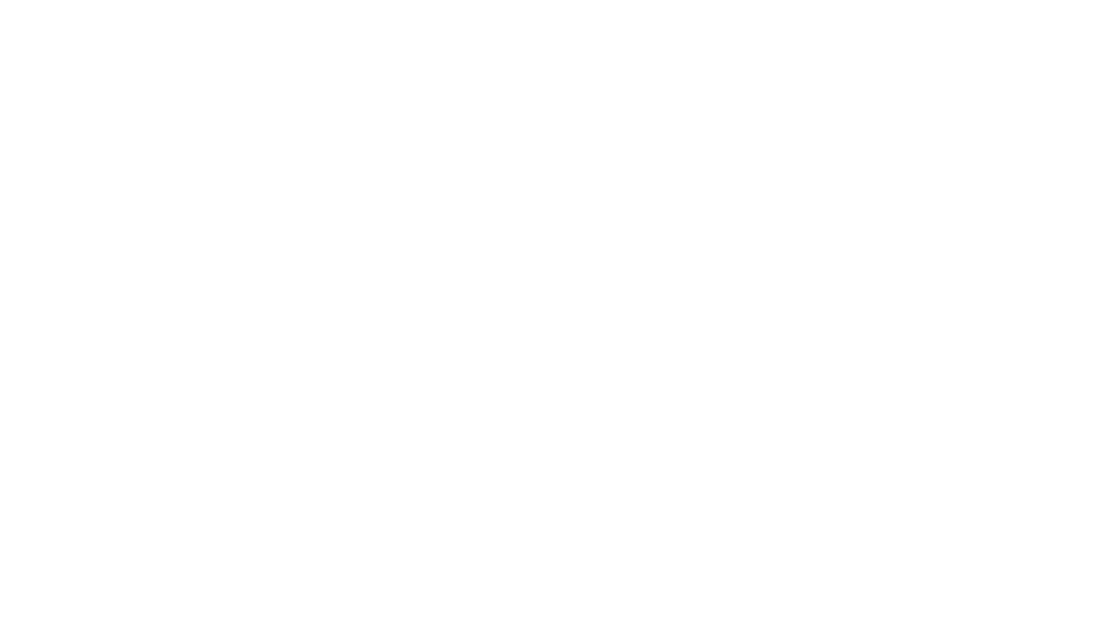
"Lorenza Böttner. Requiem für die Norm" Ausstellung im Württembergsichen Kunstverein Stuttgart
Der Besuch einer Ausstellung
„Vor kurzem haben wir während eines Gastspiels unserer Produktion Aids-Follies in Stuttgart das Glück gehabt, in der von Paul B. Preciado kuratierten Austellung Lorenza Böttner. Requiem für die Norm zu landen. „Landen“ deshalb, weil es wirklich ein riesiger und schöner Zufall war, das genau an dem Tag der Kunstverein und Preciado einen Kuratoren-Rundgang angeboten haben. Die Art Preciados, über Lorenza Böttners Kunst zu sprechen, ihre Arbeiten in einen – auf so unterschiedlichen Ebenen (Teilhabe! Kunstmarkt! Disability! Gender!) – politischen Kontext einzubetten, war nicht nur spannend, weil man in dieser Ausstellung tatsächlich Unbekanntes erfährt und sieht. Es war extrem berührend. Ich habe es selten erlebt, dass mir politisches Sprechen und Analysieren, so nahe geht. In Lorenzas Kunst selbst spürt man diese Verbindung auch: Politik, Radikalität, aber auch Emotion, Kitsch und der Mut, sich selbst völlig aufs Spiel zu setzen. In der Oper existiert diese Querverbindung ja auch: Das Politische und das Profane, die riesige, unsagbare Emotion und die klare Analyse, die maßlose Übertreibung und der Kampf – womöglich war Oper deshalb schon immer irgendwie eine queere Gattung. Dass wir mit unserer Arbeit White Limozeen nun in der Nähe von Lorenza Böttners Arbeiten „gelandet“ sind, ist auch ein schöner Zufall: So wie es in der Ausstellung unter anderem darum geht, sichtbar zu machen, was sonst ausgeblendet wird – Teilhabe herzustellen – versuchen wir in unserer Musiktheater-Performance einen ähnlichen Zugang zur Oper und ihrem Umgang mit dem, was uns „fremd“ erscheint.“
Johannes Müller
Johannes Müller
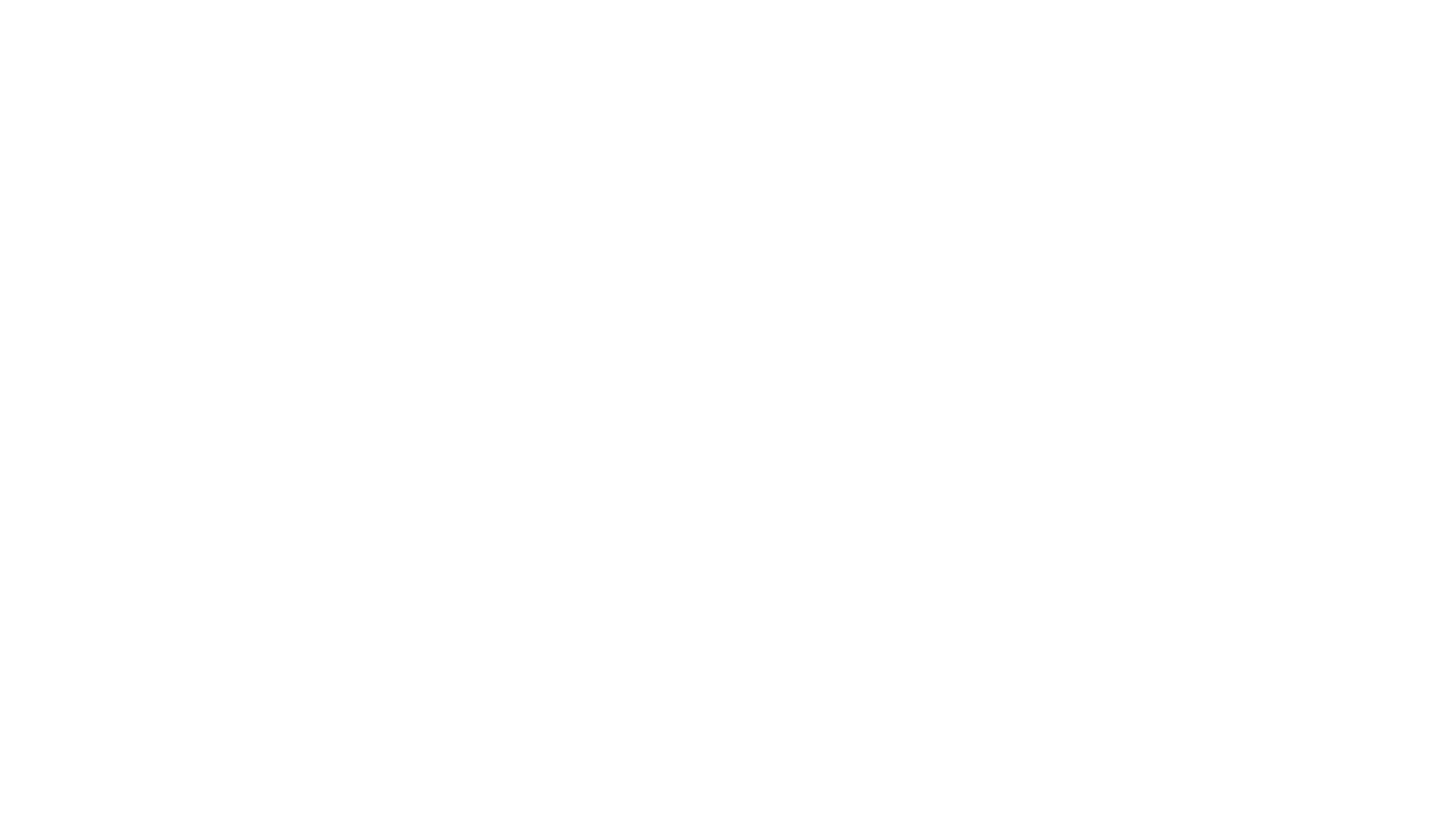
White Limozeen ist eine Musiktheater-Performance frei nach Madama Butterfly von Johannes Müller/ Philine Rinnert
White Limozeen
Das Repertoire der Oper – dieser „großen weißen und ultra-teuren Limousine des Kulturbetriebs“ (Müller/Rinnert) – ist gespickt mit Exotismus und gerät heute nicht selten unter Rassismus-Verdacht. Mit ihrer Praxis „farbenblinder“ Besetzung gilt das Genre im Critical Whiteness-Diskurs derzeit aber durchaus auch als fortschrittlich: Aida kann im Opernalltag Japanerin sein und mancherorts hat die Hälfte von Carl Maria von Webers Jägerchor Eltern in Korea. Anhand von Puccinis Oper Madama Butterfly untersuchen Johannes Müller und Philine Rinnert mit der Sopranistin Sarai Cole und der Schlagzeugerin Sabrina Ma in White Limozeen Erzähltechniken von Oper vor dem Hintergrund der Spannung zwischen kolonialer Geschichte und Alltagspraxis des Opernbusiness: Auf welche Weise wird das Fremde durch Mittel von Musik, Kostüm und Maske konstruiert?
"Lorenza Böttner. Requiem für die Norm"
Lorenza Böttner wurde 1959 als Ernst Lorenz Böttner in eine deutsche, nach Chile emigrierte Familie geboren. Mit acht Jahren erlitt er einen schweren Unfall, durch den er beide Arme verlor. 1978 begann er sein Studium an der Gesamthochschule (heute Kunsthochschule) Kassel. Sie änderte ihren Namen in Lorenza Böttner und erweiterte ihre zeichnerische und malerische Praxis durch die Einbeziehung von Tanz, Performance, Fotografie und Modedesign. Sie arbeitete mit Füßen und Mund und verwendete Fotografie, Zeichnung, Tanz, Installation und Performance als ästhetische Ausdrucksmittel. In ihren Werken widersetzt sie sich den Prozessen der Entsubjektivierung und Entsexualisierung, dem Wegsperren und Unsichtbarmachen von funktional andersartigen und Transgenderkörpern. Die Ausstellung ist eine Reise in die ebenso bemerkenswerte wie einzigartige Welt einer Künstler*in, deren Bestimmung es zu sein scheint, zu einer Klassikerin des 20. Jahrhunderts zu avancieren: als unverzichtbarer Beitrag zur Kritik an der Normalisierung des Körpers und des sozialen Geschlechts.
Eine kleine Auswahl von Lorenza Böttners Arbeiten war 2017 auf der documenta 14 in Kassel zu sehen. In Stuttgart handelt es sich um die bislang umfangreichste Präsentation ihrer Werke.
Eine kleine Auswahl von Lorenza Böttners Arbeiten war 2017 auf der documenta 14 in Kassel zu sehen. In Stuttgart handelt es sich um die bislang umfangreichste Präsentation ihrer Werke.