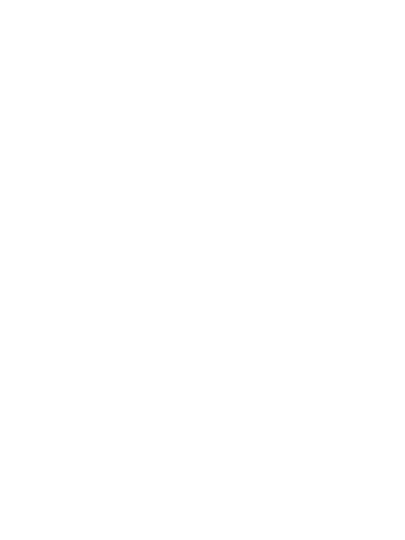zurück
21.03.2023 Wie klingt die Natur?
Wie klingt die Natur?
Schließt man im 3. Sinfoniekonzert die Augen, kommen einem sofort Bilder von den Weiten des Ozeans und der Imposanz der Berge. Egal ob Hèctor Parras Auftragskomposition „Ich ersehne die Alpen“, Benjamin Brittens „Four Sea Interludes“, Jean Sibelius' „Okeaniden“ oder Claude Debussys „La Mer“ – sie alle bringen die Natur zum Klingen. Wir haben die am Konzert beteiligten Künstler*innen gefragt, was sie in den Werken hören.
Das Schimmern
Benjamin Britten, Four Sea Interludes, op. 33a (1945)
Moonlight ist das Herzstück dieser vier Zwischenspiele und die paradoxe Zusammenführung von Trost, Unsicherheit und drohendem Unheil. Etwas Mysteriöses kommt hinter der Nebelwand hervor. Britten stellt nicht einfach das Naturphänomen der rauen englischen See lautmalerisch dar, er zeichnet ein emotionales Seelenbild der Menschen, um die es geht. Das Register ist tief angelegt, Hörner mischen sich mit dunklen Streichern, Bratschen und Celli, die anschwellen wie ein warmes Pulsieren, immer wieder durchbrochen von irrlichternden Xylofonkaskaden. All das in Es-Dur, einer Tonart, die oft mit Gold assoziiert wird, als würde die nächtliche See gülden schimmern. Als Quartsextakkorde wirken sie instabil, so instabil, wie Dur nun mal klingen kann. Dadurch entsteht das Gefühl eines Trosts, der nicht tragen wird. Britten neigt zum Spaltklang, zum Herben, das hört man in den anderen drei Sätzen; Moonlight dagegen ist rund – vielleicht das bruchloseste Stück im ganzen Werk.
Thomas Guggeis, Dirigent
Benjamin Britten, Four Sea Interludes, op. 33a (1945)
Moonlight ist das Herzstück dieser vier Zwischenspiele und die paradoxe Zusammenführung von Trost, Unsicherheit und drohendem Unheil. Etwas Mysteriöses kommt hinter der Nebelwand hervor. Britten stellt nicht einfach das Naturphänomen der rauen englischen See lautmalerisch dar, er zeichnet ein emotionales Seelenbild der Menschen, um die es geht. Das Register ist tief angelegt, Hörner mischen sich mit dunklen Streichern, Bratschen und Celli, die anschwellen wie ein warmes Pulsieren, immer wieder durchbrochen von irrlichternden Xylofonkaskaden. All das in Es-Dur, einer Tonart, die oft mit Gold assoziiert wird, als würde die nächtliche See gülden schimmern. Als Quartsextakkorde wirken sie instabil, so instabil, wie Dur nun mal klingen kann. Dadurch entsteht das Gefühl eines Trosts, der nicht tragen wird. Britten neigt zum Spaltklang, zum Herben, das hört man in den anderen drei Sätzen; Moonlight dagegen ist rund – vielleicht das bruchloseste Stück im ganzen Werk.
Thomas Guggeis, Dirigent
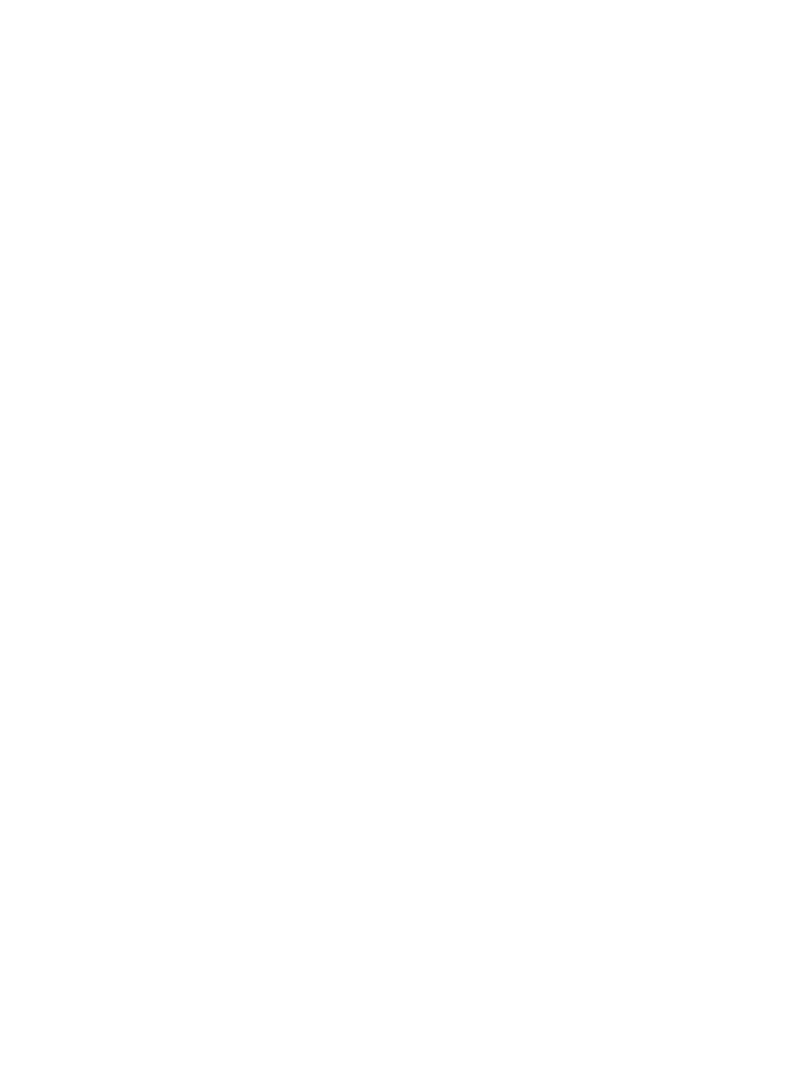
Das Tanzen
Jean Sibelius, Die Okeaniden, op. 73 (1914)
Mit einem geheimnisvollen Grummeln der Pauken und zarten, wiegenden Linien der Streicher entführt Sibelius die Zuhörenden hinab in die Tiefen des Meeres. Benannt hat der finnische Komponist seine Tondichtung nach den Nymphen der griechischen Mythologie, den Töchtern des Meeresgottes Okeanos. Ihr heiterer Reigen durch die lichtdurchfluteten Wellen spiegelt sich in der tänzerischen Melodie der Flöten wider. Allmählich verdüstert sich jedoch die Atmosphäre, die Bewegungen werden unruhiger, das anfängliche Grummeln erhält etwas Bedrohliches. Eindrucksvoll beschreibt Sibelius das Aufziehen eines Sturms mit dem dramatischen Aufbrausen des Orchesters: Winde tosen über das Wasser, und eine große Welle türmt sich auf. Sämtliche Meereswesen scheinen wild umherzuhuschen, bis die Welle schließlich bricht und die Meeresoberfläche mit dem Klang der Holzbläser wieder in ruhigem Glanz erstrahlt. Dann wartet man gebannt darauf, dass die Okeaniden erneut hervorkommen und sich zum Tanz versammeln.
Claudia Jahn, Konzertdramaturgin
Jean Sibelius, Die Okeaniden, op. 73 (1914)
Mit einem geheimnisvollen Grummeln der Pauken und zarten, wiegenden Linien der Streicher entführt Sibelius die Zuhörenden hinab in die Tiefen des Meeres. Benannt hat der finnische Komponist seine Tondichtung nach den Nymphen der griechischen Mythologie, den Töchtern des Meeresgottes Okeanos. Ihr heiterer Reigen durch die lichtdurchfluteten Wellen spiegelt sich in der tänzerischen Melodie der Flöten wider. Allmählich verdüstert sich jedoch die Atmosphäre, die Bewegungen werden unruhiger, das anfängliche Grummeln erhält etwas Bedrohliches. Eindrucksvoll beschreibt Sibelius das Aufziehen eines Sturms mit dem dramatischen Aufbrausen des Orchesters: Winde tosen über das Wasser, und eine große Welle türmt sich auf. Sämtliche Meereswesen scheinen wild umherzuhuschen, bis die Welle schließlich bricht und die Meeresoberfläche mit dem Klang der Holzbläser wieder in ruhigem Glanz erstrahlt. Dann wartet man gebannt darauf, dass die Okeaniden erneut hervorkommen und sich zum Tanz versammeln.
Claudia Jahn, Konzertdramaturgin
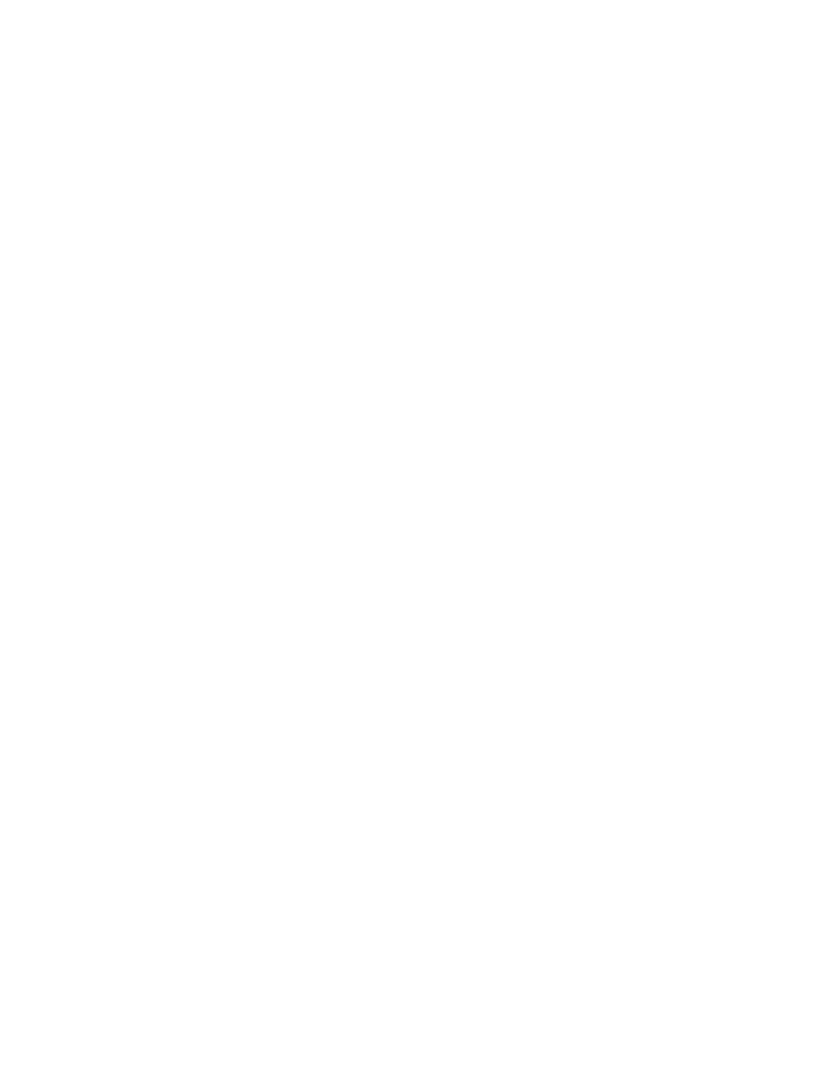
Der Anstieg
Hèctor Parra, Ich ersehne die Alpen, Monodram
von Händl Klaus für Sopran,
Elektronik und Orchester (Uraufführung)
Dieses Stück ist wie ein Dialog. Die Protagonistin unterhält sich mit den Alpen, sie sehnt sich nach ihnen und sagt: „Ich will hinauf, ich will zu euch.“ Aber sie erhält keine Antwort. Als würde sie vor dieser gewaltigen Kulisse aus voller Seele rufen, aber es kommt kein Echo zurück. Die dissonanten Harmonien in der Komposition sind rhythmisch komplex: Triolen-, Quintolen- und Septolen-Bewegungen sowie viele Tremoli bringen ihr inneres Beben zum Ausdruck. Durch die langen, dynamisch gestalteten Phrasen, von laut zu leise, von auf- zu absteigend, ist es, als würde sie den Berg erklimmen – und oben wird die Luft immer dünner. Eine beklemmende Wirkung. Mich faszinieren Berge aus geologischer Sicht, die Tatsache, wie uralt sie sind, wie Flora und Fauna in dieser Kargheit bestehen. Auf dem Gipfel überwältigt einen dann dieses majestätische Gefühl. Man wird sich seines Menschseins bewusst – aber auch seiner eigenen Kleinheit.
Josefin Feiler, Sopranistin
Hèctor Parra, Ich ersehne die Alpen, Monodram
von Händl Klaus für Sopran,
Elektronik und Orchester (Uraufführung)
Dieses Stück ist wie ein Dialog. Die Protagonistin unterhält sich mit den Alpen, sie sehnt sich nach ihnen und sagt: „Ich will hinauf, ich will zu euch.“ Aber sie erhält keine Antwort. Als würde sie vor dieser gewaltigen Kulisse aus voller Seele rufen, aber es kommt kein Echo zurück. Die dissonanten Harmonien in der Komposition sind rhythmisch komplex: Triolen-, Quintolen- und Septolen-Bewegungen sowie viele Tremoli bringen ihr inneres Beben zum Ausdruck. Durch die langen, dynamisch gestalteten Phrasen, von laut zu leise, von auf- zu absteigend, ist es, als würde sie den Berg erklimmen – und oben wird die Luft immer dünner. Eine beklemmende Wirkung. Mich faszinieren Berge aus geologischer Sicht, die Tatsache, wie uralt sie sind, wie Flora und Fauna in dieser Kargheit bestehen. Auf dem Gipfel überwältigt einen dann dieses majestätische Gefühl. Man wird sich seines Menschseins bewusst – aber auch seiner eigenen Kleinheit.
Josefin Feiler, Sopranistin
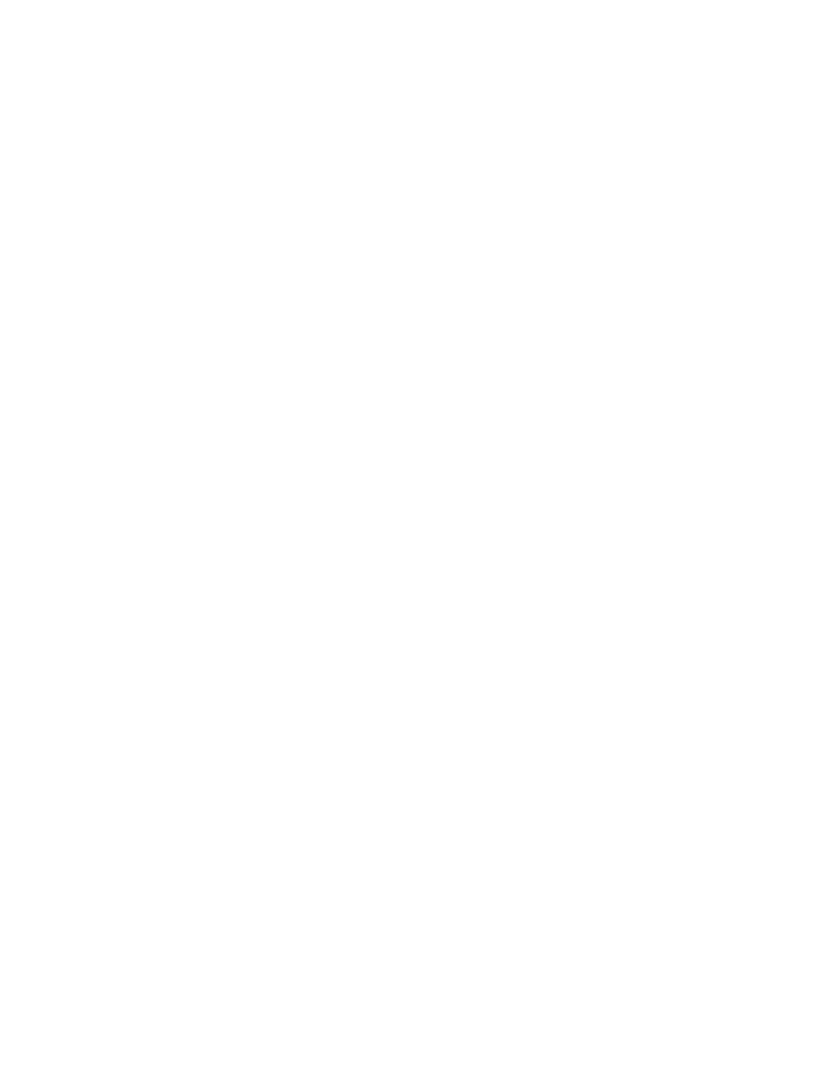
Das Tosen
Claude Debussy, La Mer, Drei sinfonische Skizzen für Orchester (1905)
Gegen Ende des ersten Satzes hört man, wie die Sonne den Nebel verdrängt. Man hat das Meer bisher nur erahnen können und kommt ihm näher wie ein Wanderer, der von einer Klippe herabsieht. Alles ist noch verschwommen, unklar und in der Ferne, bevor das Meer wirklich da ist, wie ein großer glatter Spiegel, vom Licht beschienen. Mit der Harfe zu Beginn des zweiten Satzes wird die Stimmung verwunschen. Man taucht ein
in eine verspielte Unterwasserwelt, in der es kleine, leichte Bewegungen gibt, Glitzer von Sonne, die durchs Wasser fällt, Luftblasen, die aufsteigen. Bis sich die Farben im letzten Satz völlig ändern: dunkel, düster, bedrohlich, kein Glitzer mehr. Der Wind zieht auf, die Gischt spritzt, Wellen knallen aufeinander, das Meer tost. Man hört die Reaktion auf etwas, das unausweichlich ist, weil sich das Wasser dem Wind beugen muss, auf seine Energie reagiert. Am Ende, wenn der Sturm sich beruhigt hat, kommt das Aufatmen.
Franziska Baur, Violinistin
Claude Debussy, La Mer, Drei sinfonische Skizzen für Orchester (1905)
Gegen Ende des ersten Satzes hört man, wie die Sonne den Nebel verdrängt. Man hat das Meer bisher nur erahnen können und kommt ihm näher wie ein Wanderer, der von einer Klippe herabsieht. Alles ist noch verschwommen, unklar und in der Ferne, bevor das Meer wirklich da ist, wie ein großer glatter Spiegel, vom Licht beschienen. Mit der Harfe zu Beginn des zweiten Satzes wird die Stimmung verwunschen. Man taucht ein
in eine verspielte Unterwasserwelt, in der es kleine, leichte Bewegungen gibt, Glitzer von Sonne, die durchs Wasser fällt, Luftblasen, die aufsteigen. Bis sich die Farben im letzten Satz völlig ändern: dunkel, düster, bedrohlich, kein Glitzer mehr. Der Wind zieht auf, die Gischt spritzt, Wellen knallen aufeinander, das Meer tost. Man hört die Reaktion auf etwas, das unausweichlich ist, weil sich das Wasser dem Wind beugen muss, auf seine Energie reagiert. Am Ende, wenn der Sturm sich beruhigt hat, kommt das Aufatmen.
Franziska Baur, Violinistin