
zurück
06.10.2023 Endlich zu Hause!
Endlich zu Hause!
Es ist der eine Ort, an dem wir immer einen
Platz haben, an dem wir regelmäßig all unsere
Freund*innen treffen, an dem wir uns wirklich
verstanden fühlen: das Theater. Eine Ode an einen ganz besonderen Ort von Albrecht Selge.
Platz haben, an dem wir regelmäßig all unsere
Freund*innen treffen, an dem wir uns wirklich
verstanden fühlen: das Theater. Eine Ode an einen ganz besonderen Ort von Albrecht Selge.
Nein, wir waren überhaupt nicht zu Hause eingesperrt – wir standen draußen vor der Tür. Bewusst schreibe ich „wir“, und das, obwohl ich gar nicht zu den Schlimmsten gehöre. Die Schlimmsten sind die, die immer schon da sind: Rabiat-Abonnent*innen, die nicht eine, sondern viele „Serien“ besitzen. Opernfanatiker*innen, die sich nicht wie normale Leute fragen: „O Gott, warum singen die bloß, statt zu sprechen?“, sondern sich eher im übrigen Leben da draußen wundern, warum die Menschen eigentlich sprechen, statt zu singen. Oder Bühnen-Aficionados, die quasi im Theater wohnen wie der von Adrien Brody gespielte Regisseur Schubert Green in Wes Andersons Film Asteroid City. (Zugegeben, diesen Schubert Green hat seine Frau zu Hause rausgeschmissen; aber der Ehekrach ist doch auch nur eine Metapher für das Leben.)
„Wir“ waren also ausgesperrt, nicht eingesperrt, als wir damals zu Hause bleiben sollten, statt ins Theater, in die Oper, ins Konzert zu gehen.
Es kommt mir bereits unwirklich lang her vor, fast wie ein wirrer Traum. Aber vielleicht ist es ein gutes Zeichen, wie rasant sich unser Kulturleben allen Lamenti und Untergangsarien zum Trotz erholt hat. Selbst wenn mancher Kulturbetrieb noch mit zögerlicher Publikumsrückkehr zu kämpfen hat und der ein oder andere Besucher sich unbehaglich fühlen mag im wiedervereinten Kunst-Atmen und -Husten und doch lieber bei der Maske bleibt.
Völlig in Ordnung. Wie es auch völlig in Ordnung war, als damals eine sehr junge Frau vor laufender Kamera in Tränen ausbrach, weil sie auf keine Partys mehr gehen könne und das nicht aushalte. Eine unangenehme, gehässige Spottwelle brach in den sozialen Medien über die weinende Teenagerin herein: Na, was das denn für ein Problem sei! Keine Party, lächerlich! Töricht war der Spott zudem. Nicht nur, weil die Spötter*innen wohl ihre eigene Jugend verdrängt haben mussten, das absolut Brenzlige des jeweils nächsten Events, sondern auch, weil der Hohn schlicht ignorierte, dass wir Menschen nun mal durch und durch soziale Wesen sind.
Völlig in Ordnung. Wie es auch völlig in Ordnung war, als damals eine sehr junge Frau vor laufender Kamera in Tränen ausbrach, weil sie auf keine Partys mehr gehen könne und das nicht aushalte. Eine unangenehme, gehässige Spottwelle brach in den sozialen Medien über die weinende Teenagerin herein: Na, was das denn für ein Problem sei! Keine Party, lächerlich! Töricht war der Spott zudem. Nicht nur, weil die Spötter*innen wohl ihre eigene Jugend verdrängt haben mussten, das absolut Brenzlige des jeweils nächsten Events, sondern auch, weil der Hohn schlicht ignorierte, dass wir Menschen nun mal durch und durch soziale Wesen sind.
Sogar die Eigenbrötler*innen und Kulturnerds.
Die sind eine Kategorie jener, „die immer schon da sind“, wenn wir ins Theater gehen. Wollte man sie insgesamt typologisieren, würde ihre Bandbreite sich über alle Erscheinungsformen des Menschlichen erstrecken. Das gilt schon rein physisch. Zwei der in Berlin bekanntesten Immer-da-Besucher*innen etwa sind: eine winzig kleine ältere Frau japanischer Herkunft, ein bärenbreiter vollbärtiger Schrank von Mann mit Schweizer Wurzeln. Sie würde vermutlich dreimal in ihn hineinpassen. Aber er ist überaus sanftmütig und frisst keine Menschen, er verschlingt lediglich Kunst. Die beiden habe ich im Lauf der Jahre kennengelernt, sie sind durchaus freundlich, gesprächig, gesellig, überhaupt nicht verschroben (höchstens ein bisschen).
Andere grüßt man, ohne sich zu kennen, oder man sieht sie immer wieder. Wie diesen ganz alten Mann, ein hagerer Greis von sympathischem, mild scheinendem Wesen, einige Jahre auf Krücken, zuletzt im Rollstuhl in Begleitung einer auch nicht mehr ganz taufrischen Frau, die ich für seine Tochter hielt. Auch der Krückengreis versäumte nichts, trank im Theater immer erst ein Glas Weißwein, schleppte sich nach der Aufführung mühsam Richtung Taxistand. Irgendwann fiel mir auf, dass ich ihn schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatte. Es ist wie ein Fehler im Universum, wenn einer von denen, die immer da sind, plötzlich fehlt. Dieser Mensch gehört schließlich hierher. Der kosmische Fehler ist natürlich unsere Sterblichkeit, diese elende, widerwärtige Institution. Und obwohl ich den milden Krückengreis gar nicht persönlich kannte, zündete ich während eines langsamen Konzertsatzes in Gedanken eine Kerze für ihn an, für alle Fälle.
Andere grüßt man, ohne sich zu kennen, oder man sieht sie immer wieder. Wie diesen ganz alten Mann, ein hagerer Greis von sympathischem, mild scheinendem Wesen, einige Jahre auf Krücken, zuletzt im Rollstuhl in Begleitung einer auch nicht mehr ganz taufrischen Frau, die ich für seine Tochter hielt. Auch der Krückengreis versäumte nichts, trank im Theater immer erst ein Glas Weißwein, schleppte sich nach der Aufführung mühsam Richtung Taxistand. Irgendwann fiel mir auf, dass ich ihn schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatte. Es ist wie ein Fehler im Universum, wenn einer von denen, die immer da sind, plötzlich fehlt. Dieser Mensch gehört schließlich hierher. Der kosmische Fehler ist natürlich unsere Sterblichkeit, diese elende, widerwärtige Institution. Und obwohl ich den milden Krückengreis gar nicht persönlich kannte, zündete ich während eines langsamen Konzertsatzes in Gedanken eine Kerze für ihn an, für alle Fälle.
Ganz gleich, ob wir Theater & Co. nun als Eremitage begreifen oder als Bekloppten-WG, in der wir ein Zimmer haben, als stetigen Lebenswasserhahn oder als Todesvertröstungskammer: Es ist ein Zuhause, und gewiss nicht das unwahrste.
Die einen betreten da für zwei oder drei Stunden eine metropolitane Einsiedelei ihrer innersten Bedürfnisse, andere treffen regelmäßig liebe Bekannte und Freunde. Man sieht sich bei der Einführung, am Buffet, am festen Platz. Wie in einem verlängerten Wohnzimmer; nur dass man niemanden in die Wohnung lassen, nichts servieren, nicht aufräumen muss. Man ist am Ziel, man darf in der Kunst versinken, in diesem Paradox der absoluten Intimität im voll besetzten Raum: unter vielen ganz bei sich zu sein (während man daheim oft genug unter niemandem ist und doch ganz ohne sich selbst). Oder man kann endlich mal wieder ungestört schlafen … Auch das ist in Ordnung, es soll ja sogar Menschen geben, die im Theatersaal besser schlafen können als in ihrem sogenannten Zuhause.
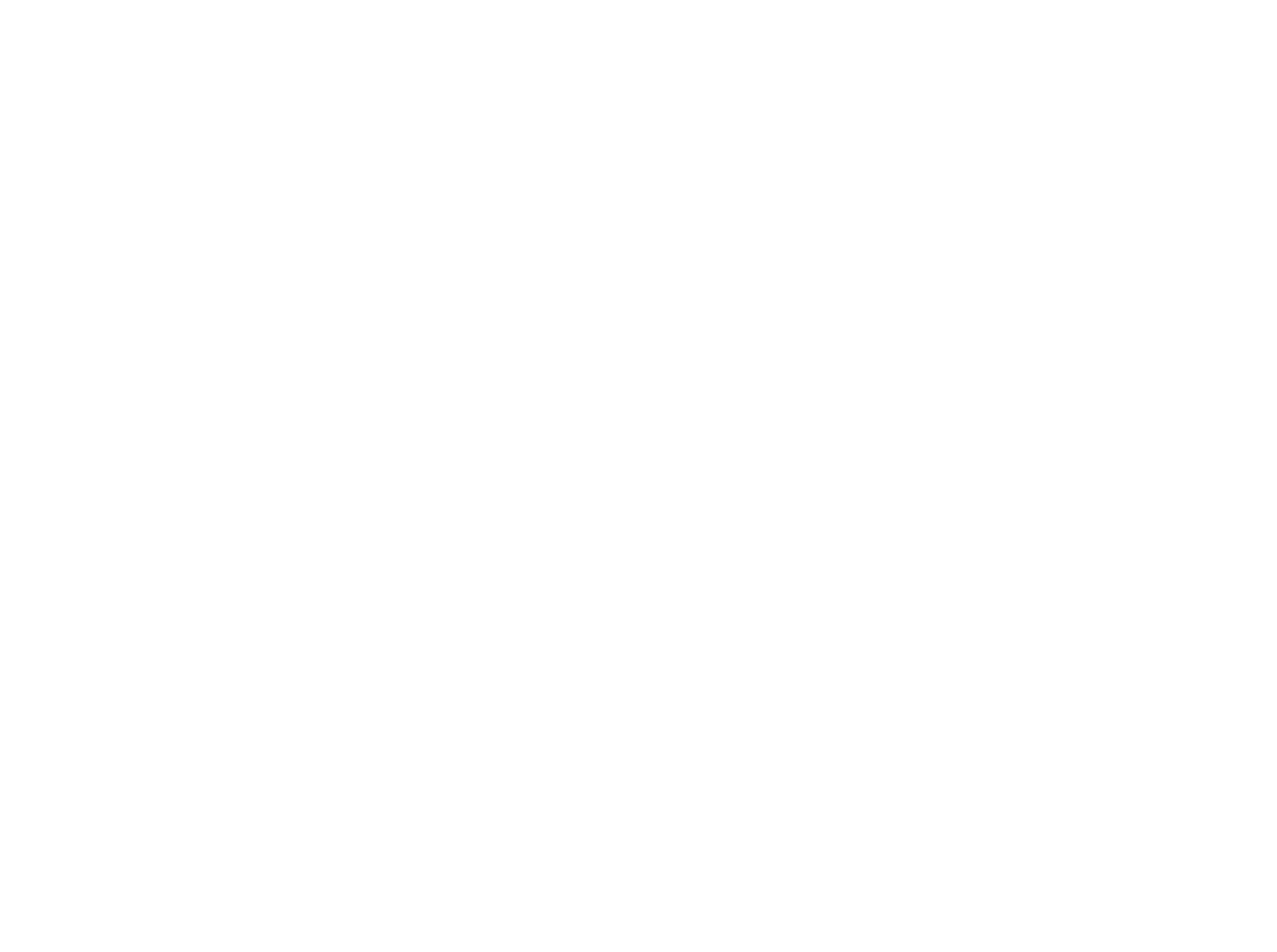
Die Wäsche im Foyer II. Rang hat Tenor und Kammersänger Heinz Göhrig aufgehängt. Foto: Saeed Kakavand
Für die einen also ist es Sucht, für die anderen Gewohnheit. Die Theaterstätte ist seit der Antike sozialer Begegnungsort und (ersatz)religiöser Ort zugleich. Und so ist die Sucht keine Sucht, von der man Heilung wünscht, sondern frei gewählte Wunschsucht, und die Gewohnheit keine lästige, zu erledigende, sondern befreiende, stets von Neuem ersehnte. Ob Junkie oder Routinier, für uns alle hält es die Glückseligkeit des Rituellen bereit.
Und deshalb waren für viele von uns der kalte Entzug und die Gewohnheitsdurchbrechung, als pandemiebedingt die Kulturtüren vor unseren Nasen und Herzen geschlossen wurden, so hart. Als Vernünftige oder Vernünftigseinwollende muckten wir nicht, es starben ja Menschen, und als Empathiefähige begehrten wir, „nicht schuld daran zu sein“, wie es im Kriegslied von Matthias Claudius heißt. Aber wir litten. So wie die junge Frau litt, die nicht mehr im Partygewühl unter ihren Freundinnen und Freunden sein konnte und damit nicht mehr sie selbst.
„Kraftwerk der Gefühle“, so lautet eine der abgedroschensten Bezeichnungen für das Gesamtkunstwerk Oper. Aber nachdem wir so lange ausgesperrt waren und draußen vor der Tür standen, da merken wir jetzt, da wir wieder drin sind, was uns die Musik, das Theater zu sein verspricht:
Und deshalb waren für viele von uns der kalte Entzug und die Gewohnheitsdurchbrechung, als pandemiebedingt die Kulturtüren vor unseren Nasen und Herzen geschlossen wurden, so hart. Als Vernünftige oder Vernünftigseinwollende muckten wir nicht, es starben ja Menschen, und als Empathiefähige begehrten wir, „nicht schuld daran zu sein“, wie es im Kriegslied von Matthias Claudius heißt. Aber wir litten. So wie die junge Frau litt, die nicht mehr im Partygewühl unter ihren Freundinnen und Freunden sein konnte und damit nicht mehr sie selbst.
„Kraftwerk der Gefühle“, so lautet eine der abgedroschensten Bezeichnungen für das Gesamtkunstwerk Oper. Aber nachdem wir so lange ausgesperrt waren und draußen vor der Tür standen, da merken wir jetzt, da wir wieder drin sind, was uns die Musik, das Theater zu sein verspricht:
Schlüsseldienst unserer Seelen, Eintritt ins wahre Zuhause, das im Unwirklichen liegt.
Albrecht Selge lebt als musikalischer Omnivore in Berliner Konzertsälen und Opernhäusern, verschmäht auch kein Theater. Zur Überbrückung der Schließzeiten verdingt er sich als Schriftsteller, zuletzt mit den Romanen Beethovn und Luyánta (beide Rowohlt). Der Text erschien zunächst in Reihe 5, dem Magazin der Staatstheater Stuttgart.