
zurück
04.10.2021 Die Verurteilung des Lukullus: Alles auf Augenhöhe
„Alles auf Augenhöhe“
2012 gründeten Franziska Kronfoth und Julia Lwowski das Musiktheaterkollektiv „Hauen und Stechen“, mit dem sie ein bewegendes, zeitgemäßes und genreübergreifendes Musiktheater anstreben. Die enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern wie der Kostümbildnerin Yassu Yabara führt zu einer performativen und unverwechselbaren Theatersprache.
Frau Lwowski, Frau Kronfoth und Frau Yabara, in der Oper Die Verurteilung des Lukullus, für die Bertolt Brecht das Libretto und Paul Dessau die Musik geschrieben hat, geht es um den römischen Feldherrn. Der muss im Totenreich, vor einer Art Jüngstem Gericht, Rechenschaft über seine Verdienste auf Erden ablegen. Wie kamen Sie auf den Stoff?
Julia Lwowski: Die Staatsoper Stuttgart hat uns das Stück vorgeschlagen. Wir haben uns diese eher selten gespielte Oper aus DDR-Zeiten dann angeschaut, und sie hat uns fasziniert. Insbesondere das Libretto von Brecht.
Franziska Kronfoth: Die Anklage ist das Politische an dem Werk. Als die Oper entstand, hatten Brecht und Dessau die Hoffnung, den Blick auf die Geschichte und die Welt zu verändern. Denn die Geschichte wird immer wieder über große Männer erzählt, das ist aber eben nicht die Wahrheit, zumindest nicht die ganze. Bei Lukullus wird ein anderer Blick eingenommen, zugunsten der weniger privilegierten Bevölkerung, der Soldaten, Mütter und Kinder. Die Idee ist, Geschichte aus einer anderen Perspektive zu schreiben. So stellt sich viel eher die Frage, wie man im Krieg überleben kann, und die großen Schlachten rücken in den Hintergrund.
Die Anklage gegen Lukullus endet in dem berühmten Satz: „Ins Nichts mit ihm!“ Ist diese Verwerfung der große Perspektivwechsel?
Lwowski: Ja! Es ist auch ein moralisches Problem, an dem wir uns abarbeiten. Denn diese Verurteilung, „Ins Nichts mit ihm!“, ist rigoros. Und zwar so rigoros, wie zuvor jene verurteilt waren, die nun urteilen. Hier werden die alten Wunden mit neuen überdeckt. Wo aber ist da die Lösung? Dieses klare moralische Schema müssen wir auch vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs verstehen. Wir können das nach Jahrzehnten ohne Krieg hierzulande kaum noch nachvollziehen. Die Verurteilung der Großen und Mächtigen, das wirkt abstrakt. Das müssen wir für uns wieder greifbar machen. Und das funktioniert über die Figur des Lukullus sehr gut.
Yassu Yabara: Mir hat geholfen, Lukullus genauer zu betrachten. Er ist nämlich sehr erstaunt über seine Verurteilung. Das erleben wir heute ähnlich, dieses große Erstaunen über die Tatsache, dass sich Paradigmen ändern. Oder dass aus Ohnmacht Macht werden kann. Zugleich ist dieses Erstaunen das Menschlichste an dem Stück. Denn Lukullus wird immer sprachloser und schriller. Über diese Haltung habe ich einen Zugang gefunden.
Julia Lwowski: Die Staatsoper Stuttgart hat uns das Stück vorgeschlagen. Wir haben uns diese eher selten gespielte Oper aus DDR-Zeiten dann angeschaut, und sie hat uns fasziniert. Insbesondere das Libretto von Brecht.
Franziska Kronfoth: Die Anklage ist das Politische an dem Werk. Als die Oper entstand, hatten Brecht und Dessau die Hoffnung, den Blick auf die Geschichte und die Welt zu verändern. Denn die Geschichte wird immer wieder über große Männer erzählt, das ist aber eben nicht die Wahrheit, zumindest nicht die ganze. Bei Lukullus wird ein anderer Blick eingenommen, zugunsten der weniger privilegierten Bevölkerung, der Soldaten, Mütter und Kinder. Die Idee ist, Geschichte aus einer anderen Perspektive zu schreiben. So stellt sich viel eher die Frage, wie man im Krieg überleben kann, und die großen Schlachten rücken in den Hintergrund.
Die Anklage gegen Lukullus endet in dem berühmten Satz: „Ins Nichts mit ihm!“ Ist diese Verwerfung der große Perspektivwechsel?
Lwowski: Ja! Es ist auch ein moralisches Problem, an dem wir uns abarbeiten. Denn diese Verurteilung, „Ins Nichts mit ihm!“, ist rigoros. Und zwar so rigoros, wie zuvor jene verurteilt waren, die nun urteilen. Hier werden die alten Wunden mit neuen überdeckt. Wo aber ist da die Lösung? Dieses klare moralische Schema müssen wir auch vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs verstehen. Wir können das nach Jahrzehnten ohne Krieg hierzulande kaum noch nachvollziehen. Die Verurteilung der Großen und Mächtigen, das wirkt abstrakt. Das müssen wir für uns wieder greifbar machen. Und das funktioniert über die Figur des Lukullus sehr gut.
Yassu Yabara: Mir hat geholfen, Lukullus genauer zu betrachten. Er ist nämlich sehr erstaunt über seine Verurteilung. Das erleben wir heute ähnlich, dieses große Erstaunen über die Tatsache, dass sich Paradigmen ändern. Oder dass aus Ohnmacht Macht werden kann. Zugleich ist dieses Erstaunen das Menschlichste an dem Stück. Denn Lukullus wird immer sprachloser und schriller. Über diese Haltung habe ich einen Zugang gefunden.
Die Idee ist, Geschichte aus einer anderen Perspektive zu schreiben.
Franziska Kronfoth
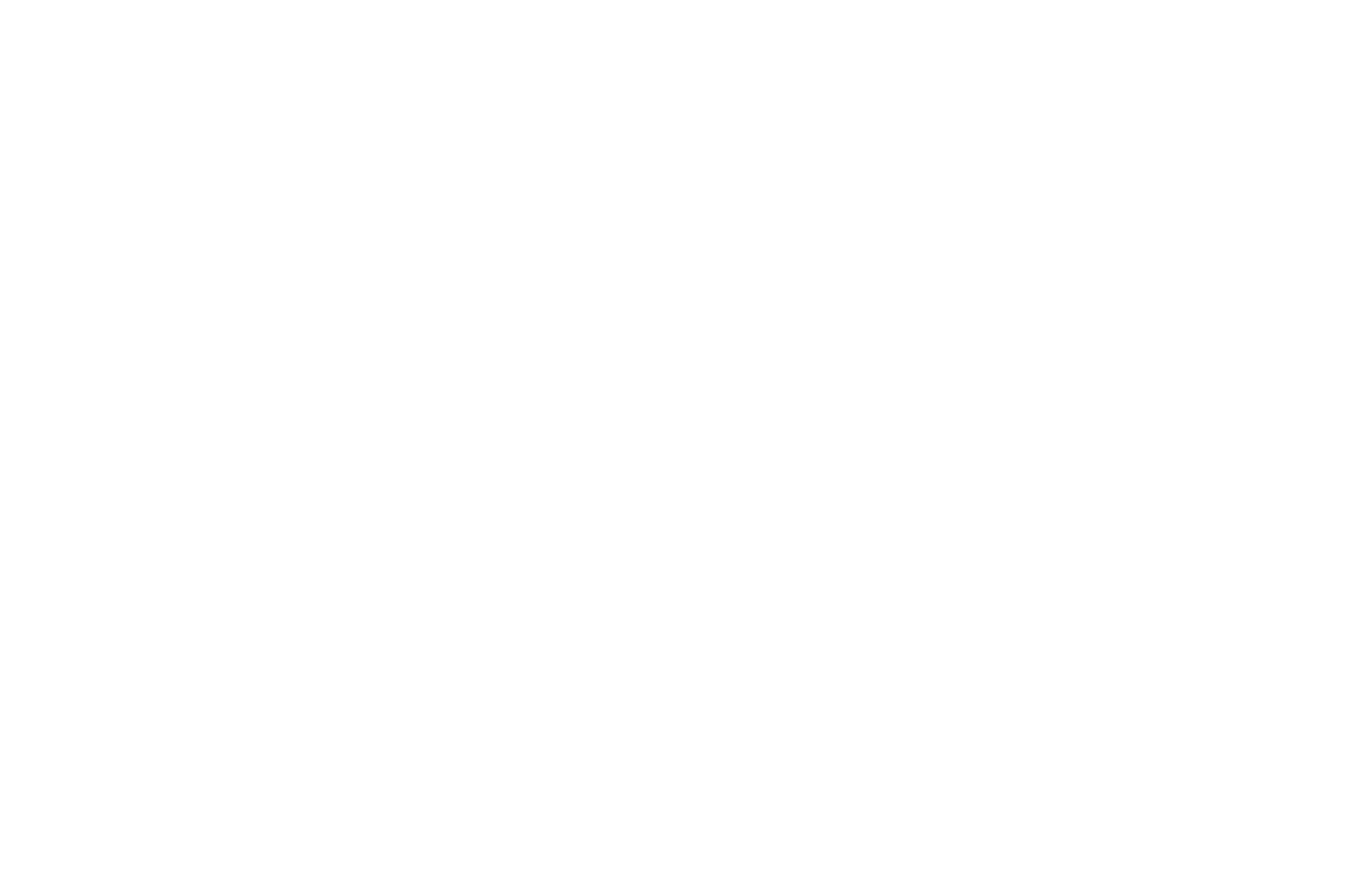
Franziska Kronfoth, Foto von Max Zimmermann
Einerseits gibt es bei Ihnen eine große Distanz zu dem Stoff, vor allem in Hinblick auf die historischen Erfahrungen, andererseits einen aktuellen Zugang. Sind das verschiedene Aspekte des Werks?
Lwowski: Für uns ist die Oper von Brecht und Dessau wie ein geschichteter archäologischer Baumkuchen. Die Schichten bestehen nicht nur aus der Handlung im vorchristlichen römischen Imperium, sondern auch aus den verschiedenen Arbeitsphasen in Brechts dänischem Exil über das Nachkriegsdeutschland bis zur jungen DDR. Dann gibt es wichtige Inszenierungen, vor allem von Ruth Berghaus, Dessaus Frau. Und als wir vor drei Jahren mit dem Stück in Kontakt kamen, war die Welt auch noch mal eine andere als jetzt.
Lwowski: Für uns ist die Oper von Brecht und Dessau wie ein geschichteter archäologischer Baumkuchen. Die Schichten bestehen nicht nur aus der Handlung im vorchristlichen römischen Imperium, sondern auch aus den verschiedenen Arbeitsphasen in Brechts dänischem Exil über das Nachkriegsdeutschland bis zur jungen DDR. Dann gibt es wichtige Inszenierungen, vor allem von Ruth Berghaus, Dessaus Frau. Und als wir vor drei Jahren mit dem Stück in Kontakt kamen, war die Welt auch noch mal eine andere als jetzt.
Mein Lieblingsinstrument in Lukullus ist das Trautonium. Nur wenige kennen das Instrument noch, das war gewissermaßen einer der ersten Synthesizer.
Julia Lwowski
Die Musik von Dessau sorgte bei der Uraufführung 1951 zum Teil für Irritationen, insbesondere der vielfältige Einsatz des Schlagwerks. Möglicherweise zeigte sich darin die Erfahrung des Krieges, es hallte aber vor allem „modernistisch“ und „formalistisch“ nach. Wie gehen Sie mit der Musik um?
Kronfoth: Wir haben großes Glück mit unserem Dirigenten Bernhard Kontarsky. Mit ihm zusammen haben wir die Partitur genau studiert und interessante Dinge herausgefunden. Zum Beispiel, dass Dessau viele der Szenen neu kontrastierend und charakteristisch mit Kammerensembles besetzt, in verschiedenen Kombinationen. Wir holen die Instrumentalisten dieser Kammermusiken auf die Bühne, den Akkordeonisten, die Flöten, das Trautonium als Unterweltinstrument.
Yabara: Hannah Arendt sagte zur Premiere von Lukullus, Brecht sei ein schlechter Dichter, wenn er lüge. Sie warf ihm vor, für die Partei zu schreiben. So unterschiedlich wurde das in Ost und West gesehen, auch im Hinblick auf den modernistischen Charakter. Da merkt man, unter welchen Bedingungen dieses Stück entstanden ist. Man fragt sich: Wo ist Menschlichkeit, wo Feinheit, wo Wahrheit? Und wo möglicherweise nur Ideologie? Je genauer man hinschaut, desto mehr Brüche und Widersprüche entdeckt man im Werk. Diese auszustellen, nicht aufzulösen, das ist für uns interessant.
Klingt die Musik in Ihren Ohren noch so, als könnte sie irritieren? Oder haben sich in den
vergangenen siebzig Jahren die Hörgewohnheiten so verändert, dass das gar nicht mehr der Fall ist?
Lwowski: Mein Lieblingsinstrument in Lukullus ist das Trautonium. Nur wenige kennen das Instrument noch, das war gewissermaßen einer der ersten Synthesizer. Am ehesten ist es bekannt aus Alfred Hitchcocks Film Die Vögel, es macht dort den unheimlichen Sound. Lukullus ist sehr fein instrumentiert, selbst wenn Ketten zum Einsatz kommen oder Steine auf Metallplatten gehauen werden. Oder das Fiepen, das Flageolett der Celli, beim Eintritt in die Unterwelt, das sind sehr präzise eingesetzte musikalische Mittel. Deren Reiz verfliegt nicht. Der arme Dessau hat völlig zu Unrecht für seine Musik so viel Kritik einstecken müssen, dabei ist sie ein wahrer Schatz.
Kronfoth: Die Musik lebt von ihren starken Kontrasten. Und von ihren experimentellen Momenten. Das funktioniert sehr gut für die Oper. Das ist ein Werk, das man jederzeit neu befragen kann, wie es auch Berghaus in ihren zahlreichen Inszenierungen gemacht hat. Sie war sehr einflussreich, nicht nur für das Musiktheater der DDR, sondern auch darüber hinaus.
Kronfoth: Wir haben großes Glück mit unserem Dirigenten Bernhard Kontarsky. Mit ihm zusammen haben wir die Partitur genau studiert und interessante Dinge herausgefunden. Zum Beispiel, dass Dessau viele der Szenen neu kontrastierend und charakteristisch mit Kammerensembles besetzt, in verschiedenen Kombinationen. Wir holen die Instrumentalisten dieser Kammermusiken auf die Bühne, den Akkordeonisten, die Flöten, das Trautonium als Unterweltinstrument.
Yabara: Hannah Arendt sagte zur Premiere von Lukullus, Brecht sei ein schlechter Dichter, wenn er lüge. Sie warf ihm vor, für die Partei zu schreiben. So unterschiedlich wurde das in Ost und West gesehen, auch im Hinblick auf den modernistischen Charakter. Da merkt man, unter welchen Bedingungen dieses Stück entstanden ist. Man fragt sich: Wo ist Menschlichkeit, wo Feinheit, wo Wahrheit? Und wo möglicherweise nur Ideologie? Je genauer man hinschaut, desto mehr Brüche und Widersprüche entdeckt man im Werk. Diese auszustellen, nicht aufzulösen, das ist für uns interessant.
Klingt die Musik in Ihren Ohren noch so, als könnte sie irritieren? Oder haben sich in den
vergangenen siebzig Jahren die Hörgewohnheiten so verändert, dass das gar nicht mehr der Fall ist?
Lwowski: Mein Lieblingsinstrument in Lukullus ist das Trautonium. Nur wenige kennen das Instrument noch, das war gewissermaßen einer der ersten Synthesizer. Am ehesten ist es bekannt aus Alfred Hitchcocks Film Die Vögel, es macht dort den unheimlichen Sound. Lukullus ist sehr fein instrumentiert, selbst wenn Ketten zum Einsatz kommen oder Steine auf Metallplatten gehauen werden. Oder das Fiepen, das Flageolett der Celli, beim Eintritt in die Unterwelt, das sind sehr präzise eingesetzte musikalische Mittel. Deren Reiz verfliegt nicht. Der arme Dessau hat völlig zu Unrecht für seine Musik so viel Kritik einstecken müssen, dabei ist sie ein wahrer Schatz.
Kronfoth: Die Musik lebt von ihren starken Kontrasten. Und von ihren experimentellen Momenten. Das funktioniert sehr gut für die Oper. Das ist ein Werk, das man jederzeit neu befragen kann, wie es auch Berghaus in ihren zahlreichen Inszenierungen gemacht hat. Sie war sehr einflussreich, nicht nur für das Musiktheater der DDR, sondern auch darüber hinaus.
Die konzeptionelle Arbeit findet in der Gruppe statt. Jeder von uns hat einen eigenen Bereich, die Hierarchien sind flach.
Franziska Kronfoth
Bei dem Wort Kollektiv denkt man unweigerlich an die DDR: Kollektiv der sozialistischen Arbeit. Los ging es für Hauen und Stechen 2012, in den Kellerräumen der Galerina Steiner in Berlin. Eine der frühen Aufführungen spielte in einem Hinterhof in Neukölln, auf der Flucht vor Nachbarn wurde das Publikum mit Taxis in ein Bestattungsinstitut gefahren. Und nun sind Sie an den großen Opernhäusern angekommen. Was verbinden Sie mit dem Begriff „Kollektiv“?
Kronfoth: Die konzeptionelle Arbeit findet in der Gruppe statt. Jeder von uns hat einen eigenen Bereich, die Hierarchien sind flach. Das meint, dass die Regie nicht der kreative Kopf ist und die anderen nur ausführen, sondern dass sich alle mit ihren Gedanken und Ideen einbringen. Dadurch entsteht eine Vielstimmigkeit, ein Kaleidoskop aus Perspektiven. Als Kollektiv kommen wir mit unseren Leuten an die Theater, mit der Schauspielerin Gina-Lisa Maiwald und ihrem Kollegen Thorbjörn Björnsson, Martin Mallon fürs Video und Christina Schmitt für die Bühne. Alle bringen sich ein. Alles auf Augenhöhe.
Yabara: Es ist nicht immer einfach, wenn wir mit unserem Mikrokosmos an ein Stadt- oder Staatstheater kommen. Aber wenn man diese Offenheit und Neugier spürt wie in Stuttgart, wenn es nicht zu Missverständnissen kommt, kann das sehr bereichernd sein. Für uns ist es ein großes Geschenk, auf die Möglichkeiten eines Opernhauses zurückgreifen zu können.
Lwowski: Wir vergessen aber auch unsere Anfänge mit der Dunkelheit, dem Staub und der Enge aus diesen Kellerräumen nicht. Ebenso wenig wie die Geschichte. Franziska kommt aus der DDR, ich selbst aus der Sowjetunion, das sind prägende Einflüsse. Wir sind auf eine gewisse Weise sehr treu. Auch bei den Arbeitsbeziehungen, die einmal entstanden sind.
Was bedeutet das konkret?
Yabara: Bei uns geht es sehr stark um den Dialog. Das kommt aus dem Bewusstsein dafür, dass man sich in einem gemeinsamen Raum befindet. Wir wollen nicht predigen, uns gefällt viel eher die Idee des Rituals, das gemeinsame Erleben und Herausfinden. Und das versuchen wir immer zu berücksichtigen, ob es nun acht oder achthundert Zuschauer sind.
Kronfoth: Am Ende kommt alles zusammen, unsere gemeinsame Auseinandersetzung, ob theoretisch, historisch oder ästhetisch. Und spielerisch soll es letztlich sein. Es geht nicht nur darum, eine Rolle zu verkörpern, sondern mehr noch darum, das Verkörpern einer Rolle zu zeigen, wie bei Brecht. Aus den verschiedenen Aspekten setzt sich dann für den Zuschauer ein Bild zusammen, das zunächst auch widersprüchlich sein kann. Je reicher das Resultat am Ende ist, desto glücklicher sind wir. Die Kraft kommt aus der Eigenständigkeit der Beteiligten.
Lwowski: Wir kennen uns auch schon lange, das ist ein Vorteil. Es beglückt und gibt Ruhe. Das ist auch nicht ohne Konflikte. Aber zehn Jahre gemeinsame Geschichte schaffen Vertrauen. Ohne das wäre die Verausgabung, die Ekstase und das Überbordende nicht möglich, was für uns zum Theater unbedingt dazugehört.
Kronfoth: Die konzeptionelle Arbeit findet in der Gruppe statt. Jeder von uns hat einen eigenen Bereich, die Hierarchien sind flach. Das meint, dass die Regie nicht der kreative Kopf ist und die anderen nur ausführen, sondern dass sich alle mit ihren Gedanken und Ideen einbringen. Dadurch entsteht eine Vielstimmigkeit, ein Kaleidoskop aus Perspektiven. Als Kollektiv kommen wir mit unseren Leuten an die Theater, mit der Schauspielerin Gina-Lisa Maiwald und ihrem Kollegen Thorbjörn Björnsson, Martin Mallon fürs Video und Christina Schmitt für die Bühne. Alle bringen sich ein. Alles auf Augenhöhe.
Yabara: Es ist nicht immer einfach, wenn wir mit unserem Mikrokosmos an ein Stadt- oder Staatstheater kommen. Aber wenn man diese Offenheit und Neugier spürt wie in Stuttgart, wenn es nicht zu Missverständnissen kommt, kann das sehr bereichernd sein. Für uns ist es ein großes Geschenk, auf die Möglichkeiten eines Opernhauses zurückgreifen zu können.
Lwowski: Wir vergessen aber auch unsere Anfänge mit der Dunkelheit, dem Staub und der Enge aus diesen Kellerräumen nicht. Ebenso wenig wie die Geschichte. Franziska kommt aus der DDR, ich selbst aus der Sowjetunion, das sind prägende Einflüsse. Wir sind auf eine gewisse Weise sehr treu. Auch bei den Arbeitsbeziehungen, die einmal entstanden sind.
Was bedeutet das konkret?
Yabara: Bei uns geht es sehr stark um den Dialog. Das kommt aus dem Bewusstsein dafür, dass man sich in einem gemeinsamen Raum befindet. Wir wollen nicht predigen, uns gefällt viel eher die Idee des Rituals, das gemeinsame Erleben und Herausfinden. Und das versuchen wir immer zu berücksichtigen, ob es nun acht oder achthundert Zuschauer sind.
Kronfoth: Am Ende kommt alles zusammen, unsere gemeinsame Auseinandersetzung, ob theoretisch, historisch oder ästhetisch. Und spielerisch soll es letztlich sein. Es geht nicht nur darum, eine Rolle zu verkörpern, sondern mehr noch darum, das Verkörpern einer Rolle zu zeigen, wie bei Brecht. Aus den verschiedenen Aspekten setzt sich dann für den Zuschauer ein Bild zusammen, das zunächst auch widersprüchlich sein kann. Je reicher das Resultat am Ende ist, desto glücklicher sind wir. Die Kraft kommt aus der Eigenständigkeit der Beteiligten.
Lwowski: Wir kennen uns auch schon lange, das ist ein Vorteil. Es beglückt und gibt Ruhe. Das ist auch nicht ohne Konflikte. Aber zehn Jahre gemeinsame Geschichte schaffen Vertrauen. Ohne das wäre die Verausgabung, die Ekstase und das Überbordende nicht möglich, was für uns zum Theater unbedingt dazugehört.
Julia und Franziska haben Hauen und Stechen aus strukturellen Gründen gegründet. Sie hatten den Eindruck, dass sie als weibliche Regisseure nicht wahr- und ernst genommen werden.
Yassu Yabara
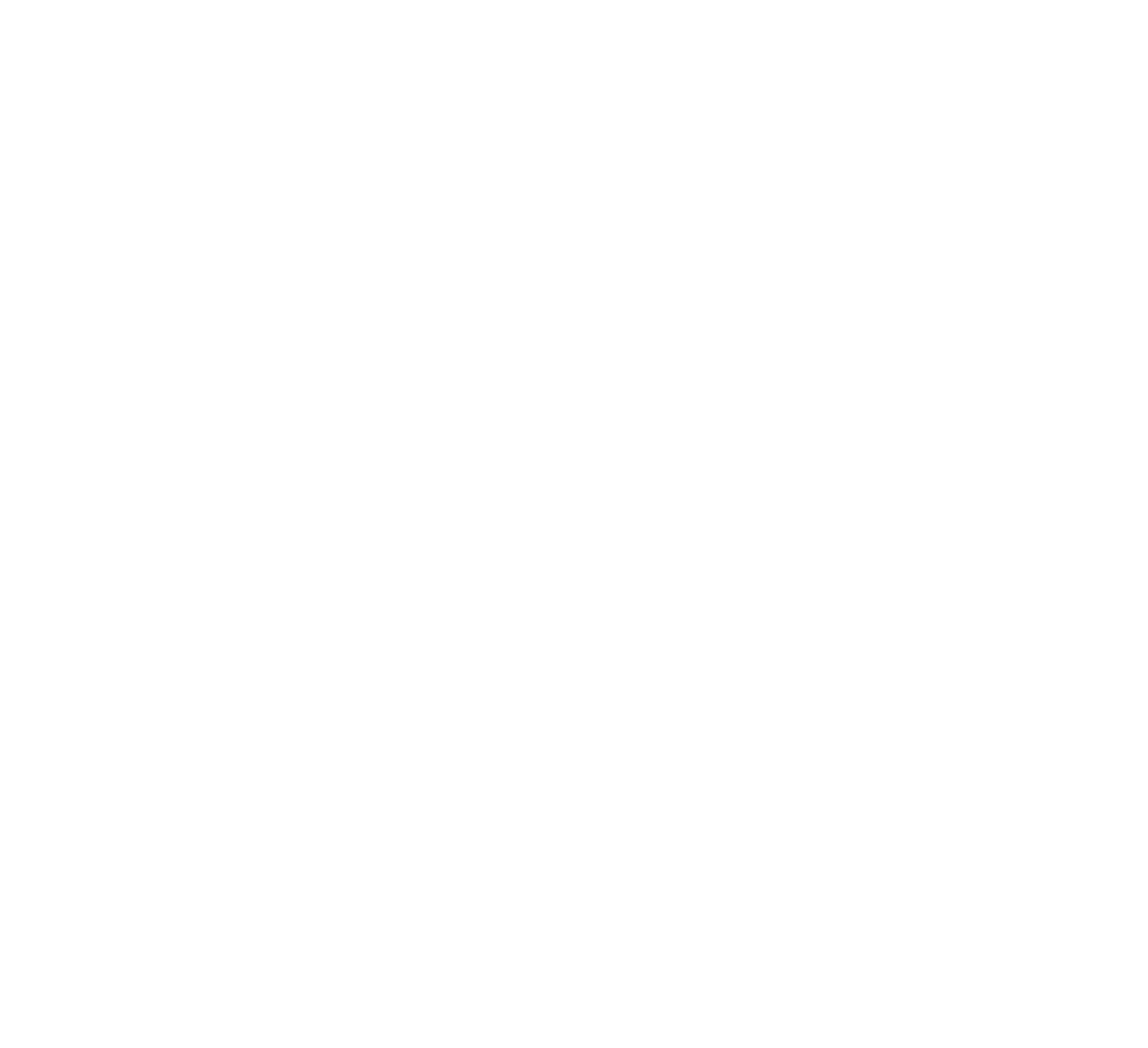
Julia Lwowski, Foto von Max Zimmermann
In Lukullus geht es um Macht und Männlichkeit, die angegriffen werden. Eine Debatte, die auch den Theaterbetrieb zurzeit umtreibt. Wie ist Ihr Blick auf die momentane Bühnenwelt?
Kronfoth: Es ist wichtig, dass alle gute Arbeitsbedingungen haben. Gute Stücke entstehen nicht durch Kampf, Diktatur und Angst. Gute gemeinsame Arbeit macht Hierarchien überflüssig.
Lwowski: Wichtig ist auch, dass weibliche Kollektive die Möglichkeit haben, etwas auf der großen Bühne zu zeigen. Es sollte Normalität sein. Noch besser wäre es, wenn man es nicht extra betonen müsste, aber so weit sind wir noch nicht.
Yabara: Julia und Franziska haben Hauen und Stechen aus strukturellen Gründen gegründet. Sie hatten den Eindruck, dass sie als weibliche Regisseure nicht wahr- und ernst genommen werden. Daraus ist eine wunderbare künstlerische Identität entstanden, aber es begann mit einer Ablehnung. Man hat es ihnen als jungen Frauen ohne männlichen Regiemeister im Hintergrund nicht zugetraut, eine Oper zu inszenieren. Die Sprache unseres Kollektivs wird auch immer wieder vehement abgelehnt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir all diesen Zweifeln als Gruppe ein größeres Gewicht entgegensetzen können. Wir zerfasern weniger an Selbstzweifeln, und es bleibt mehr Kraft zu überzeugen.
Kronfoth: Ich habe aufgehört, mich mit dieser Ablehnung zu beschäftigen. Die gibt es bestimmt immer noch, aus welchen Gründen auch immer. Am Anfang der eigenen Laufbahn lag es auf der Hand, sich damit auseinanderzusetzen. Man ist sehr schnell auf Geschlechterstereotypen und Geniekult gestoßen. Jetzt versuche ich, keine Kraft mehr darauf zu verschwenden. Es ist wichtig, dass wir unsere Kunst machen: eigen, feministisch, mit Hingabe. Und durch die Arbeiten unsere künstlerische Daseinsberechtigung behaupten.
Wie sollte die Oper von morgen aussehen?
Kronfoth: Mehr weibliche Regisseure! Und wir müssen weg von dem globalisierten und kapitalisierten Starsystem im Opernbetrieb. Das verhindert, dass einzelne Häuser eine eigene Identität entwickeln. Außerdem müsste sich mehr getraut werden, im Umgang mit dem Werk und zusammen mit dem Orchester. Es muss um Kunst gehen, um Experiment und um Vielstimmigkeit.
Apropos Vielstimmigkeit: Christoph Schlingensief schrieb einmal, freies Denken ende in Partituren. Wie ist das zu verstehen? Wird das freie Denken durch die Partitur beschränkt, oder mündet es darin, dass die Partitur der Vielstimmigkeit eine Form gibt?
Kronfoth: Jede Theateraufführung ist eine große Partitur, mit allen Abläufen, den Auftritten, den Abgängen, der Musik, den Videoeinspielern und so weiter. Und das ist das Resultat der gemeinsamen freien Arbeit, eine Verabredung.
Lwowski: Oder endet das freie Denken eben doch dort, wo die Partitur anfängt? Sobald man eine Improvisation aufschreibt, also zur Partitur macht, ist es keine freie Improvisation mehr, das kennt man aus dem Jazz. Aber, um mir gleich zu widersprechen: Eine Partitur ermöglicht auch die Freiheit der Interpretation, da lässt sich so viel machen. Eine Partitur ist erst mal Material. Und dann entsteht ein großes Miteinander, manchmal auch Gegeneinander, aber das ist das Tolle beim Musiktheater.
Kronfoth: Es ist wichtig, dass alle gute Arbeitsbedingungen haben. Gute Stücke entstehen nicht durch Kampf, Diktatur und Angst. Gute gemeinsame Arbeit macht Hierarchien überflüssig.
Lwowski: Wichtig ist auch, dass weibliche Kollektive die Möglichkeit haben, etwas auf der großen Bühne zu zeigen. Es sollte Normalität sein. Noch besser wäre es, wenn man es nicht extra betonen müsste, aber so weit sind wir noch nicht.
Yabara: Julia und Franziska haben Hauen und Stechen aus strukturellen Gründen gegründet. Sie hatten den Eindruck, dass sie als weibliche Regisseure nicht wahr- und ernst genommen werden. Daraus ist eine wunderbare künstlerische Identität entstanden, aber es begann mit einer Ablehnung. Man hat es ihnen als jungen Frauen ohne männlichen Regiemeister im Hintergrund nicht zugetraut, eine Oper zu inszenieren. Die Sprache unseres Kollektivs wird auch immer wieder vehement abgelehnt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir all diesen Zweifeln als Gruppe ein größeres Gewicht entgegensetzen können. Wir zerfasern weniger an Selbstzweifeln, und es bleibt mehr Kraft zu überzeugen.
Kronfoth: Ich habe aufgehört, mich mit dieser Ablehnung zu beschäftigen. Die gibt es bestimmt immer noch, aus welchen Gründen auch immer. Am Anfang der eigenen Laufbahn lag es auf der Hand, sich damit auseinanderzusetzen. Man ist sehr schnell auf Geschlechterstereotypen und Geniekult gestoßen. Jetzt versuche ich, keine Kraft mehr darauf zu verschwenden. Es ist wichtig, dass wir unsere Kunst machen: eigen, feministisch, mit Hingabe. Und durch die Arbeiten unsere künstlerische Daseinsberechtigung behaupten.
Wie sollte die Oper von morgen aussehen?
Kronfoth: Mehr weibliche Regisseure! Und wir müssen weg von dem globalisierten und kapitalisierten Starsystem im Opernbetrieb. Das verhindert, dass einzelne Häuser eine eigene Identität entwickeln. Außerdem müsste sich mehr getraut werden, im Umgang mit dem Werk und zusammen mit dem Orchester. Es muss um Kunst gehen, um Experiment und um Vielstimmigkeit.
Apropos Vielstimmigkeit: Christoph Schlingensief schrieb einmal, freies Denken ende in Partituren. Wie ist das zu verstehen? Wird das freie Denken durch die Partitur beschränkt, oder mündet es darin, dass die Partitur der Vielstimmigkeit eine Form gibt?
Kronfoth: Jede Theateraufführung ist eine große Partitur, mit allen Abläufen, den Auftritten, den Abgängen, der Musik, den Videoeinspielern und so weiter. Und das ist das Resultat der gemeinsamen freien Arbeit, eine Verabredung.
Lwowski: Oder endet das freie Denken eben doch dort, wo die Partitur anfängt? Sobald man eine Improvisation aufschreibt, also zur Partitur macht, ist es keine freie Improvisation mehr, das kennt man aus dem Jazz. Aber, um mir gleich zu widersprechen: Eine Partitur ermöglicht auch die Freiheit der Interpretation, da lässt sich so viel machen. Eine Partitur ist erst mal Material. Und dann entsteht ein großes Miteinander, manchmal auch Gegeneinander, aber das ist das Tolle beim Musiktheater.
Das Interview erschien in der Oktober-Ausgabe des Monatsmagazins der Staatstheater Stuttgart, Reihe 1.
Jakob Hayner war von 2016 bis 2020 Redakteur bei Theater der Zeit. 2020 veröffentlichte er bei Matthes &Seitz sein Buch Warum Theater. Krise und Erneuerung und wechselte zur Tageszeitung nd, wo er inzwischen das Ressort für Geisteswissenschaft verantwortet.