
zurück
09.03.2023 Nach Dunkelheit kommt Licht
Nach Dunkelheit kommt Licht
Warum der berühmteste Tod der Welt am Ende doch nichts mit Sterben zu tun hat: Matthias Dell hat für „Reihe 5“, das Magazin der Staatstheater Stuttgart, mit Tenor (und Evangelist) Moritz Kallenberg über Bachs „Johannes-Passion“ gesprochen.
Herr Kallenberg, wenn man mit der Frage, was nach dem Schluss kommt, auf die Johannes-Passion schaut, also auf die Geschichte vom Leiden und Sterben Christi, wäre es erst mal gut zu wissen: Ist das für Sie eine Geschichte von einem Ende?
Nein, glaube ich nicht. Die Johannes-Passion ist höchstens dann eine Geschichte vom Ende, wenn man sie als großen Trost versteht.
Wenn die Passion kein Schluss ist, was ist sie dann?
Auf jeden Fall ist sie kein Abschluss im Sinne von: Und hier hört alles auf. Die Passion beschreibt einen ganz tiefen, intimen Moment, einen Punkt, von dem aus dann wieder weitergegangen werden muss. Es wird immer dunkler, aber je dunkler es wird, desto zwingender ist der Schritt ins Licht.
Aber woher weiß man das? Die Auferstehung selbst kommt ja im Stück nicht mehr vor.
Nein, aber die Auferstehung ist da, sie ist schon angelegt in den Chören, etwa am Ende. Da heißt es: „Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine / Die ich nun weiter nicht beweine, / Ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh! / Das Grab, so euch bestimmet ist / Und ferner keine Not umschließt, / Macht mir den Himmel auf und schließt die Hölle zu.“ Das ist kein Amen, sondern bedeutet, dass mir ein neuer Weg geöffnet wird. Auch musikalisch. Das ist ein Hammer-Stück!
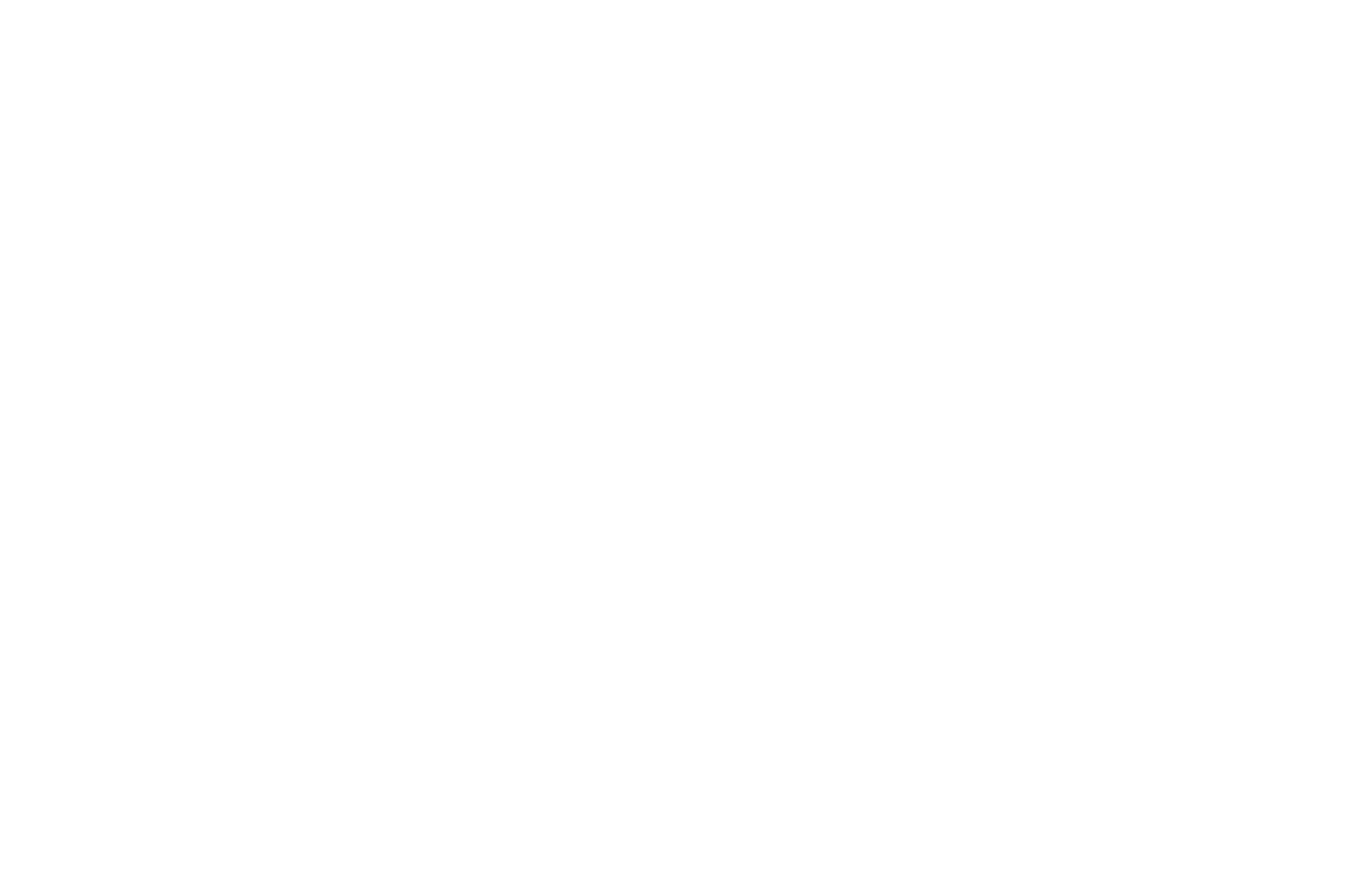
Moritz Kallenberg als Evangelist mit Jesu Ankläger in der Johannes-Passion - Foto: Matthias Baus
Kann man daraus was fürs echte Leben ziehen, oder ist das nur ein theologischer Gedanke innerhalb der Passion, dass das Leiden eine Funktion hat, einen Sinn? Und nach dem Leid muss es besser werden?
Von einer ukrainischen Familie würde man im Moment sicherlich zu viel verlangen, wenn man der sagen würde: Das mit den Bomben gerade, das ist für einen höheren Zweck, dadurch wird’s schon wieder besser. Es gibt auch einfach nur Leid, das Leid ist. Aber was sich trotzdem oft beobachten lässt: dass die Menschen an der Hoffnung festhalten, selbst im Moment größten Leidens, auch wenn das mit dem Trost total aussichtslos scheint. Hoffnung ist nie aussichtslos. Dietrich Bonhoeffer sitzt im Konzentrationslager und schreibt Gedichte und Gebete. Oder Menschen, die im Luftschutzkeller ausharren, um vor Bomben sicher zu sein, die hoffen auch. Das scheint eine große menschliche Fähigkeit zu sein, dass man auch in den hoffnungslosesten Momenten diese Hoffnung nicht verliert. Und das vermittelt die Johannes-Passion.
Welche Rolle spielt die Musik dabei?
Wenn man sich das anschaut, die Hoffnung einerseits und das Berührtsein durch Musik andererseits, dann kann man sagen: Beides lässt sich nicht auf Knopfdruck herstellen. Das muss schon irgendwo herkommen, und bei Bach ist es so, dass da wahnsinnig viele Angebote in der Passion sind, sich berühren zu lassen. Nicht unbedingt durch meinen Part als Evangelist, also als Erzähler; ich bin eher dafür da, die Geschichte voranzubringen. Aber es gibt viele Momente in den Arien, die sehr tief gehen, von denen man sich gern umgeben lässt, ich denke da etwa an die Sopranpartie „Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten.“ Es gibt auch meditative Momente, die einen zur Ruhe kommen lassen. Ich glaube, das sind dann auch die, in denen man empfänglich wird und Hoffnung schöpft.
Wie ist das denn mit dem Berührtwerden, wenn man wie Sie auf der Bühne mitwirkt? Geht das? Darf man da denken, den Part hätte ich auch gern?
Das gibt es auf jeden Fall, einfach weil manche Partien so schön sind. Gleichzeitig ist es für den Erzähler wunderbar, wenn die Figuren drum herum lebendig sind. Davon nehme ich viel mit, daran kann ich anknüpfen. So wie der Erzähler entworfen ist, gibt es Momente, die persönlich werden, und da weiß man als Zuschauer nicht genau: Erzählt er jetzt die Geschichte, oder hat er Mitleid? Es ist ja nicht so, dass ich der neutrale Zaungast bin, und den Rest macht irgendwie die schöne Musik.
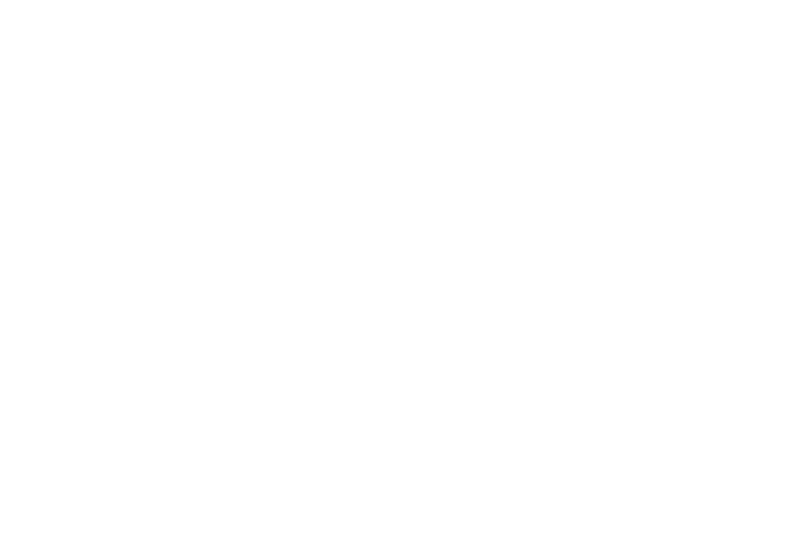
Drei große LED-Wände beherrschen das Bühnenbild von Ulrich Rasche - Foto: Matthias Baus
Vor allem machen Sie das mit der Johannes-Passion nicht zum ersten Mal. Welche Rolle spielt sie in Ihrem Sängerleben?
Die ist von Kindesbeinen an da. Ich bin aufgewachsen im Knabenchor, da war immer Bach. Weihnachtsoratorium, Johannes-Passion, Matthäus-Passion. Das ist für mich ein zentraler Part meines Schaffens, die Passionen begleiten mich mein ganzes Leben lang und werden das hoffentlich auch weiterhin tun.
Für Sie kann die Johannes-Passion also schon deshalb kein Schluss sein, weil danach immer nur die nächste kommt. Was verändert sich im Laufe der Zeit?
Das ist wie mit einem guten Roman, den liest man mit Anfang zwanzig anders als mit Mitte dreißig. Als ich jünger war, kam mir alles, was in den Arien wiederholt wird, wahnsinnig sperrig vor. Bis zu dem Punkt, an dem man auf die Uhr schaut und denkt: Wann ist das denn endlich durch? Jetzt sind das die Stellen, die ich noch mal tiefer gehen lassen kann. Ich nehme heute viel mehr wahr, was für eine wahnsinnige Qualität in den Wiederholungen steckt. Das kann ich heute besser genießen.
Und was kommt für Sie ganz buchstäblich nach dem Schluss, also wenn die Premiere geschafft ist?
Die Premiere ist das Ende von sechs bis acht Wochen Probenzeit. Da staut sich ganz viel an von der Energie, die man reingibt, Adrenalin. Das wird dann alles verbraucht am Premierenabend, das geht raus zu den Menschen, denen man zeigen möchte, was man sich bei der Aufführung gedacht hat. Direkt nach der Vorstellung ist die Anspannung noch relativ hoch, „Bühnen-High“ sage ich immer, das braucht ein paar Stunden, bis alles von einem abfällt. Dann geht erst mal gar nichts mehr, der nächste Tag ist Jogginghose. Deswegen ist die zweite Vorstellung bei vielen so gefürchtet, weil es unmöglich ist, die gleiche Spannung hinzukriegen.
Was hilft da, damit die zweite Vorstellung doch wird?
So viel Pause wie möglich nach der Premiere.
Johannes-Passion
Alle Termine