
zurück
05.10.2022 Das Fürchten lernen
Das Fürchten lernen
Seit fast 30 Jahren arbeiten Jossi Wieler, Sergio Morabito als Regieteam zusammen. Eins der gemeinsamen Werke ist die Inszenierung von Richard Wagners „Siegfried“. Nach mehr als zwanzig Jahren wird sie von den beiden gerade neu einstudiert. Ein Gespräch über Wagner und seinen „Ring“ als Hochleistungssport, als Schlaraffenland – und als Folter.
Herr Morabito, Herr Wieler, Ihre Siegfried-Inszenierung aus dem Jahr 1999 gilt als legendär, sie war damals Teil eines epochalen Ring-Projekts der Staatsoper Stuttgart. Welche Motivation steckt dahinter, den gleichen Abend jetzt noch einmal einzustudieren?
Jossi Wieler: Die Idee, die der damalige Intendant Klaus Zehelein für den Ring des Nibelungen hatte, war seinerzeit tatsächlich völlig neu: nämlich die vier Teile nicht aus einem Guss, sondern von unterschiedlichen Regisseuren inszenieren zu lassen, die sich untereinander auch ästhetisch nicht abstimmen. Das hatte es bis dahin nicht gegeben. Zehelein vertrat die Haltung, jedes einzelne Werk erfordere für sich eine derartige Verausgabung, dass ihm dieses Wagnis lohnend schien, und der Zyklus wurde auch wirklich stark beachtet. Es gab viele Nachfolgeprojekte, etwa den Ring der Frauen 2018 in Chemnitz. Die jetzige Opernleitung unter Viktor Schoner erarbeitet seit der vorigen Spielzeit nun wieder einen Ring, ebenfalls mit mehreren Regieteams, und unser Siegfried von damals fügt sich darin ein.
1999 – das scheint Äonen zurückzuliegen: Gerhard Schröder war deutscher Bundeskanzler und Boris Jelzin Präsident Russlands, 9/11 war noch nicht geschehen, und ein russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine lag außerhalb jeder Vorstellungskraft. Nicht zuletzt herrschten um die Jahrtausendwende auch andere Ästhetiken im Musik- und Sprechtheater. Inwiefern verändert das den Blick auf Ihre Inszenierung?
Sergio Morabito: Das ist tatsächlich schwer zu antizipieren, aber aus einer gewissen Erfahrung heraus würde ich sagen, dass die große Intimität unserer Arbeit, die Möglichkeit, sich von den Figuren auf überraschende Weise berühren zu lassen, im Umgang mit Richard Wagner eine Facette darstellt, die den Abend zeitenübergreifend interessant macht. Hinzu kommt, dass diese Facette auch nicht als ästhetisch durchgesetzt gelten kann, eher im Gegenteil.
Sie spielen auf Ihr sehr besonderes Inszenierungskonzept an: Bei Ihnen kommt Siegfried nicht mythisch überhöht daher, sondern ist in einer kalten, postapokalyptischen Welt angesiedelt, die von Menschen mit (Über)lebenssorgen bevölkert wird. Diese psychologische Herangehensweise ist Ihr Markenzeichen.
Morabito: Das Ziel unserer Arbeitsweise besteht darin, dass man die Figuren von innen heraus versteht. Was nicht heißt, dass man sich mit ihnen identifiziert. Siegfried, dieser junge Mensch, der unter schwierigsten Bedingungen erwachsen wird, muss in einer komplett überalterten, von historischen und gesellschaftlichen Katastrophenszenarien gesättigten Welt, in der ihn alle Seiten nur vereinnahmen wollen, seinen Weg finden. Darauf reagiert er mit einer Abwehrhaltung, die letztlich zu der Überzeugung führt, er könne sich nur noch auf sich selbst und seine physische Stärke verlassen. Dieses Entwicklungsdrama nehmen wir als Regisseure ernst, und das gleiche Interesse, das wir diesem jungen Menschen entgegenbringen, bringen wir auch für die anderen Figuren auf: Jede und jeder hat eine ganz konkrete Geschichte; eine spezifische Physiognomie, die sich eingeschrieben hat in die Seele, den Körper, die Sprache.
Wieler: Ich denke, genau wie Sergio, dass die Aktualität – heute ist sie vielleicht sogar stärker als vor 23 Jahren – darin liegt, dass wir den Figuren nicht von außen etwas überstülpen, sondern dass wir sie von innen heraus erzählen. Siegfried ist ja eigentlich ein Kammerspiel: Fast alle Szenen sind Zweierszenen. In diesen Dialogen mit ihren eingeschriebenen Subtexten ist Wagner, zeitlich noch vor Henrik Ibsen und August Strindberg, wirklich ein Meister. Das wird aber häufig gar nicht so deutlich gesehen oder herausgearbeitet. Deswegen lohnt es sich, diese Figuren in ihrer ganzen Komplexität zu ergründen, im Bewusstsein von allem ideologisch Problematischen, das sich bei Wagner leider auch finden lässt.
Wieler: Ich denke, genau wie Sergio, dass die Aktualität – heute ist sie vielleicht sogar stärker als vor 23 Jahren – darin liegt, dass wir den Figuren nicht von außen etwas überstülpen, sondern dass wir sie von innen heraus erzählen. Siegfried ist ja eigentlich ein Kammerspiel: Fast alle Szenen sind Zweierszenen. In diesen Dialogen mit ihren eingeschriebenen Subtexten ist Wagner, zeitlich noch vor Henrik Ibsen und August Strindberg, wirklich ein Meister. Das wird aber häufig gar nicht so deutlich gesehen oder herausgearbeitet. Deswegen lohnt es sich, diese Figuren in ihrer ganzen Komplexität zu ergründen, im Bewusstsein von allem ideologisch Problematischen, das sich bei Wagner leider auch finden lässt.
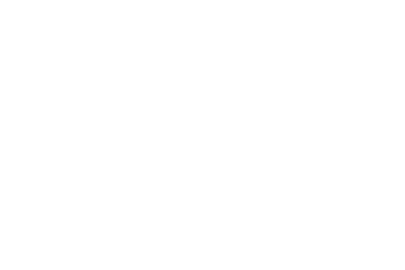
Simone Schneider als Brünnhilde und Daniel Brenna als Siegfried – Foto: Martin Sigmund
Dieser Aspekt könnte heute tatsächlich fast schon wieder avantgardistisch wirken: Inzwischen werden kanonische Stoffe, auch Auseinandersetzungen speziell mit Wagner, zumindest im Sprechtheater oft von vornherein dekonstruiert.
Wieler: Wir versuchen immer, allen Charakteren ihr Recht zu geben; sonst muss man diese Stücke nicht inszenieren. Wenn man, wie das in der Rezeptionsgeschichte tatsächlich oft geschieht, von vornherein festlegt, wer der Held ist und wer der Böse, sind solche Szenen schlichtweg uninteressant. Immer schon die Antwort zu wissen und nur noch aus der eigenen heutigen Haltung heraus zeigen zu wollen, wie die Figur eigentlich hätte reagieren müssen, wird weder dem Werk noch dem Theater gerecht.
Wie gehen Sie denn bei der Neueinstudierung des Siegfrieds konkret vor? Schauen Sie sich zuerst einen Mitschnitt Ihrer damaligen Inszenierung an, oder vertiefen Sie sich zuvor in die Musik und in Ihre eigenen Notizen?
Morabito: Bevor ich mir den Mitschnitt anschaue, nehme ich mir sehr viel Zeit, noch einmal den gesamten Text zu studieren. Es bringt eine Menge, sich ihn auch ohne die Musik zu vergegenwärtigen. Die neuen Sängerinnen und Sänger sollen ja nicht eine geronnene Form füllen, sondern sich die Charaktere mit ihren eigenen Fantasien und Fragen aneignen. Ich glaube tatsächlich, dass man Wagner über dieses befreite, differenzierte, geistesgegenwärtige
und körperliche Spiel der Darsteller eine Dimension zurückgibt oder dass man ihn sogar um eine Dimension ergänzt, die sehr kostbar ist. Dass Sängerinnen und Sänger mit der Regie komplexe Charakterstudien entwickeln, erwartet man ja normalerweise eher bei Mozart als bei Wagner, was natürlich auch mit dem Hochleistungssport zu tun hat, den das Wagnersingen in extrem gesteigerter Form bedeutet. Aber gerade deshalb finde ich diese Arbeitsweise so wichtig. Sie nimmt Wagner die Schwere und verleiht tatsächlich eine fast mozartsche Leichtigkeit und Humanität. Ihn in dieser Weise mit Humanität zu konfrontieren, statt einfach große Setzungen und Behauptungen dagegenzustellen oder ausschließlich auf den historischen Missbrauch anzuspielen, halte ich eigentlich für die subversivste Umgangsweise mit Wagners Werk. Diesen mythisch extrem stilisierten, unglaublich überhöhten Figuren eine komplexe, reiche und beglückende Menschlichkeit zu geben ist ja in gewisser Weise eine paradoxe Reaktion.
Wieler: Tatsächlich hat das, was Sergio sagt, auch mit einer Art Humor zu tun. Den braucht man für diese Figuren! Früher hieß es oft, Siegfried sei das Scherzo des Rings – aber Siegfried war eigentlich nie komisch! Im Gegenteil: Man inszenierte ihn erdenschwer. Dabei haben diese Zweierszenen, wenn man zum Beispiel an die Wissenswette zwischen Mime und dem Wanderer denkt, geradezu beckettsche Dimensionen im Sinne des Absurden als Bestandteil der Condition humaine. Ich sag’s mal inhaltlich: Die Angst – und genau darum geht es bei Siegfried ja: das Fürchten zu lernen – ist ein Komödienstoff! Das wissen wir von Buster Keaton und Charlie Chaplin.
und körperliche Spiel der Darsteller eine Dimension zurückgibt oder dass man ihn sogar um eine Dimension ergänzt, die sehr kostbar ist. Dass Sängerinnen und Sänger mit der Regie komplexe Charakterstudien entwickeln, erwartet man ja normalerweise eher bei Mozart als bei Wagner, was natürlich auch mit dem Hochleistungssport zu tun hat, den das Wagnersingen in extrem gesteigerter Form bedeutet. Aber gerade deshalb finde ich diese Arbeitsweise so wichtig. Sie nimmt Wagner die Schwere und verleiht tatsächlich eine fast mozartsche Leichtigkeit und Humanität. Ihn in dieser Weise mit Humanität zu konfrontieren, statt einfach große Setzungen und Behauptungen dagegenzustellen oder ausschließlich auf den historischen Missbrauch anzuspielen, halte ich eigentlich für die subversivste Umgangsweise mit Wagners Werk. Diesen mythisch extrem stilisierten, unglaublich überhöhten Figuren eine komplexe, reiche und beglückende Menschlichkeit zu geben ist ja in gewisser Weise eine paradoxe Reaktion.
Wieler: Tatsächlich hat das, was Sergio sagt, auch mit einer Art Humor zu tun. Den braucht man für diese Figuren! Früher hieß es oft, Siegfried sei das Scherzo des Rings – aber Siegfried war eigentlich nie komisch! Im Gegenteil: Man inszenierte ihn erdenschwer. Dabei haben diese Zweierszenen, wenn man zum Beispiel an die Wissenswette zwischen Mime und dem Wanderer denkt, geradezu beckettsche Dimensionen im Sinne des Absurden als Bestandteil der Condition humaine. Ich sag’s mal inhaltlich: Die Angst – und genau darum geht es bei Siegfried ja: das Fürchten zu lernen – ist ein Komödienstoff! Das wissen wir von Buster Keaton und Charlie Chaplin.
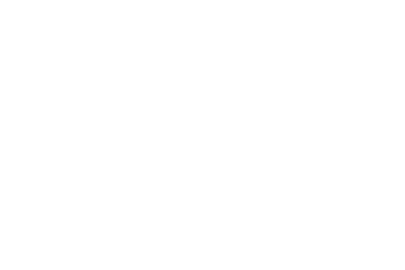
Alexandre Duhamel (Alberich) kümmert die „Lebensgefahr“ herzlich wenig. – Foto: Martin Sigmund
Für Sie, Herr Wieler, war Siegfried damals Ihre erste Wagnerregie.
Wieler: Also ich musste das Fürchten nicht lernen, bei mir war die Angst durchaus da (lacht). Ich hatte bis dahin tatsächlich fast nur Schauspiel inszeniert, und die Arbeit am Siegfried, diese Gewaltfantasien, der Inzest, die ständige Beschäftigung mit den menschlichen Abgründen, das war zeitweise wirklich wie Folter. Aber durch Siegfried ist mir Wagner deutlich näher gerückt, bei aller Distanz, die es zu vielen Aspekten seines Werks nach wie vor gibt. So ähnlich wie in jenem Märchen, in dem man sich durch einen riesigen Reisberg essen muss, um ins Schlaraffenland zu kommen. Dass ich nach und nach sehr viel bei Wagner entdecken konnte, hat aber auch mit den Gesprächen in unserem Dreierteam zu tun. Wenn ich mir daran allein die Zähne hätte ausbeißen müssen, hätte ich möglicherweise aufgegeben.
Sie arbeiten seit vielen Jahren nicht nur mit Sergio Morabito, sondern auch mit der Bühnen- und Kostümbildnerin Anna Viebrock als festes Opernregie-Trio zusammen. Wie funktioniert das konkret?
Morabito: Wir fangen grundsätzlich damit an, dass wir das Stück gemeinsam lesen und hören: Satz für Satz, Wort für Wort, über viele Tage hinweg. Dabei tauschen wir uns aus und unterbrechen uns auch gegenseitig: Moment, hier verstehe ich gar nichts mehr …
Wieler: Oder: Darüber ärgere ich mich! (beide lachen)
Wieler: Oder: Darüber ärgere ich mich! (beide lachen)
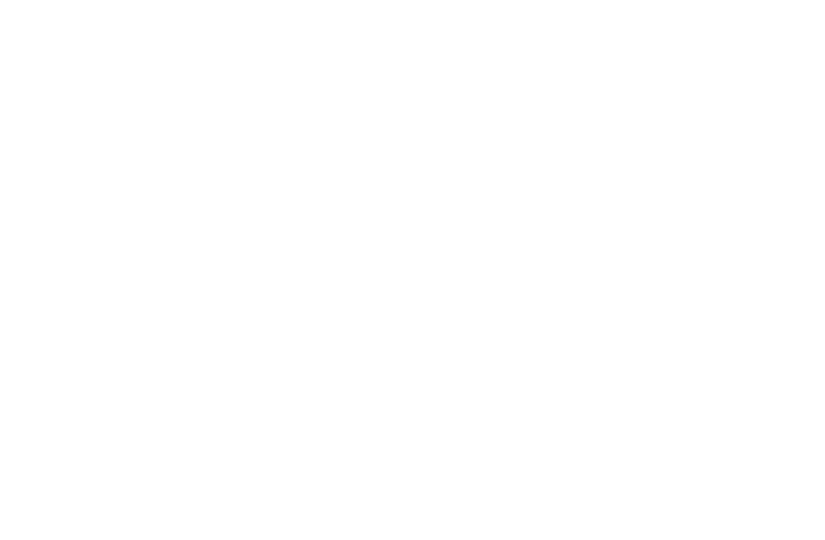
Anna Viebrock, Jossi Wieler und Sergio Morabito am Anfang ihrer Zusammenarbeit im Stuttgarter Opernhaus...
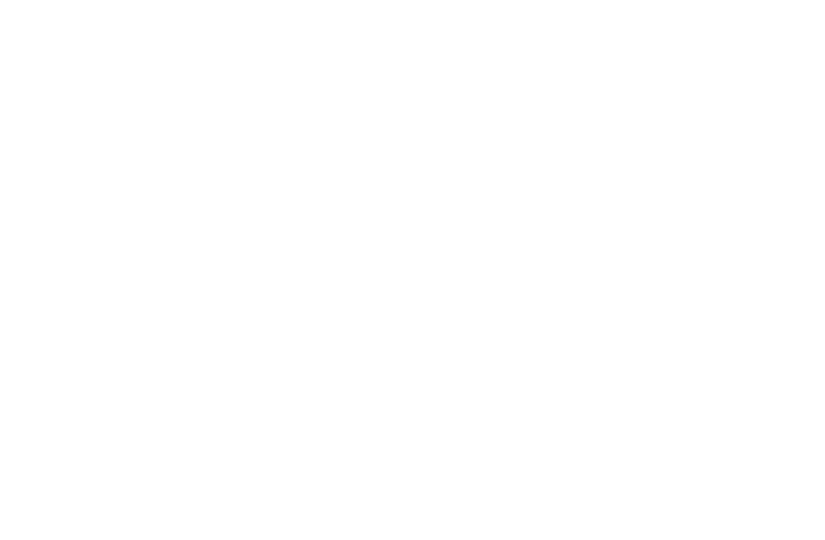
...und am Ende.
Inzwischen liegen kollektive Arbeitsweisen im Trend. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Wieler: Es wirkt nach außen immer so einfach, wenn man über Teams redet, kostet aber in Wahrheit sehr viel Kraft. Wir reden uns oft die Köpfe heiß und streiten uns auch bei gegensätzlichen Meinungen. Da sitzen Sergio und ich zum Beispiel vor einem Modell und wissen nicht weiter, oder es gibt eine Kostümidee, die einer von uns nicht mehr nachvollziehen kann. Dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und es geht nicht darum, dass man einfach per Dekret sagt, das kommt nicht infrage, sondern dass man das tatsächlich verstehen möchte.
Können Sie sich an konkrete Streitpunkte beim Siegfried erinnern?
Wieler: Die gab es auf jeden Fall, aber die Dissonanzen vergisst man, weil es letztlich zu einem Ganzen von uns allen wird. Das klingt jetzt sicher unglaublich harmonisierend, ist aber tatsächlich die Wahrheit
Siegfried
Alle Termine